Kunst und Kultur
«Dan Flavin – Widmungen aus Licht» im Kunstmuseum Basel
03.03.24 11:16

Während seiner weitgehend autodidaktischen künstlerischen Lehrjahre hielt sich Flavin mit Aushilfsjobs in New Yorker Museen über Wasser. Er arbeitete in der Poststelle des Guggenheim-Museums, wo er den Maler Ward Jackson (1928-2004) kennenlernte, der zu einem wichtigen Berater und Freund wurde. Später jobbte er im Museum of Modern Art als Aufseher und Liftboy und machte Bekanntschaft mit den Künstlern Sol LeWitt (1928-2007), Michael Venezia (geb. 1937), Robert Ryman (1930-2029), Ralph Iwamoto (1927-2013) und Robert Mangold (geb. 1937). Einige Zeit später begegnete er auch Donald Judd (1928-1994), mit dem er immer freundschaftlich verbunden blieb.


In späteren Jahren integrierte der Künstler seine Werke oft in einen bestimmten architektonischen Kontext – so wie im Innenhof des Basler Kunstmuseums. Die peinliche Geschichte dieser Installation dokumentiert Arthur Fink im Katalog. Sie beginnt mit einer vom damaligen Direktor Carlo Huber (1932-1976) kuratierten Ausstellung von Installationen Flavins in der Basler Kunsthalle und einer parallel von Direktor Franz Meyer (1919-2007) eingerichteten Präsentation grafischer Arbeiten im Kunstmuseum, die der Künstler mit Federzeichnungen des Reisläufers, Goldschmids und Künstlers Urs Graf (1485-1528) aus dem Kupferstichkabinett ergänzte. Für die Ausstellung entwickelte Flavin für den Innenhof des Museums die Installation «untitled (in memory of Urs Graf)». Am 9. Mai 1975 lehnte die Kunstkommission der Öffentlichen Kunstsammlung das Angebot ab, das Werk zu erwerben, und Ende Juni fand auch das Angebot einer Schenkung «durch eine Stiftung in Amerika» einstimmig kein Gehör. Als Grund sind im Protokoll nicht weiter ausgeführte «künstlerische Gesichtspunkte» erwähnt. Flavin war enttäuscht und schrieb das Debakel in einem Brief an Carlo Huber internen Machtkämpfen in der Kommission zu. Dabei, so seine Überzeugung, hätten die leuchtenden Röhren verdammt gut gepasst: «But after all, all of those lofty and low-down tubes seemed to me to exist oh so definitely dramatically well in that damned drab setting. Amen!» Dabei blieb es – vorerst. Die «Dia Art Foundation», die sich der Unterstützung zeitgenössischer Kunst verschrieben hatte, kaufte das Werk schliesslich an und bat 1980 die Kommission um Wiedererwägung ihres Entscheids. Diesmal war die Mehrheit der Meinung, man könne nicht ein zweites Mal nein sagen. «Mehr aus diplomatischen Erwägungen denn aus inhaltlicher Überzeugung», wie Fink schreibt, akzpetierte das Gremium das Geschenk. Es bestehe damit ja keine Verpflichtung, heisst es schlaumeierisch im Protokoll vom 11. August 1980, «die Installation anzuzünden». Und: Das Werk sei «ohnehin nur am Abend sichtbar, also zu einer Zeit, in der das Museum in der Regel geschlossen ist.» Das ist falsch, wie jetzt, wenn die Lichtskulptur leuchtet, zu sehen ist. (Übrigens: Die naheliegende Vermutung, dass die Kunstkommission Flavins Werk aus Furcht vor öffentlicher Aufregung ablehnte, ist wahrscheinlich falsch. Denn ebenfalls 1980 erwarb sie, mit einem Zusatzkredit der öffentlichen Hand, Brancusis «Torso einer jungen Frau» und nahm einen Shitstorm inklusive Fasnachtsspott ohne weiteres in Kauf.)

Zur Ausstellung ist im Verlag Walther König, Köln, für Mai ein Katalog angekündigt: Helfenstein, J., Osadtschy, O. (Hrsg): Dan Flavin - Widmungen aus Licht / Dedications in Lights. Köln 2024, 256 Seiten, €49.00.
Der Presse standen die Fahnen der Katalog-Texte zur Verfügung.
Illustrationen von oben nach unten: Porträt Dan Flavin (Ausschnitt, Foto: Stephen Flavin https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html 21.11.2006); «the diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi)», Flavins erste Leuchtstoffröhren-Installation, die ihn als Künstler etablierte. (Foto: https://www.spiegel.de/fotostrecke/lichtmaler-dan-flavin-minimaler-aufwand-maximaler-effekt-fotostrecke-17497.html, 21.11.2006); «Monument for V. Tatlin VII (1964)» (Foto aus der Ausstellung, © 2024, Jürg Bürgi, Basel); «untitled (in memory of Urs Graf)» (1975) im Innenhof des Kunstmuseums Basel (Foto © 2024 Jürg Bürgi, Basel).
Wege zum Paradies – Otto Piene im Museum Tinguely
08.02.24 14:51
Vom 7. Februar bis 12. Mai 2024 zeigt das Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Wege zum Paradies» eine umfangreiche Retrospektive auf das Werk des deutschen Künstlers Otto Piene (1928-20214). Seine riesigen, raumgreifenden Installationen waren Ausdruck seiner Überzeugung, dass Kunstschaffende eine Verantwortung für den Zustand der Welt im Allgemeinen und für das Zusammenleben der Menschen im Besonderen zu tragen haben. Zusammen mit dem Bildhauer und Maler Heinz Mack (geb. 1931) gründete Piene 1958 in Düsseldorf die Gruppe ZERO, der sich drei Jahre später auch der Objektkünstler Günther Uecker (geb. 1930) anschloss. Das gemeinsame Ziel sah die Gruppe darin, die materiellen und seelischen Verheerungen des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen und an einem Nullpunkt neu anzufangen. «Ja», schrieb Otto Piene 1961 in der dritten Nummer der Zeitschrift «ZERO», «Ich träume von einer besseren Welt. Sollte ich von einer schlechteren träumen?» Nach Angaben der Kuratorinnen Sandra Beate Reimann und Lauren Elizabeth Hanson stellt die thematisch aufgebaute Ausstellung den Wunsch Peines in den Mittelpunkt, eine harmonischere, friedvollere und nachhaltige Welt zu gestalten. Dabei wird – unter anderem anhand von 24 seiner Skizzenbücher – versucht, die Schaffensperioden bis 1966 in Düsseldorf und anschliessend am Center for Advanced Visual Studies (CAVS) am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge näher als bisher üblich zusammenzusehen.
 Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.
Das Publikum lernt Piene zunächst auf der Barka, die zu den ersten Ausstellungsräumen führt, in einer ausführlichen Präsentation seiner Lebens- und Schaffensdaten kennen, bevor ihm anhand von Zeichnungen aus einem frühen seiner insgesamt 72 Skizzenbüchern die Faszination des Künstlers für Dunkelheit und Licht vermittelt wird. Kein Zweifel die Zeit, die der erst 16-Jährige als Flak-Helfer ab 1944 in der Wehrmacht verbrachte, prägten sowohl seine Persönlichkeit als auch seine künstlerische Inspiration. Die Arbeit «Lichtraum mit Mönchengladbachwand» (1963-2013) zeigt beispielhaft, was damit gemeint ist. Das Werk weist nicht nur auf die Erinnerungen an die intensive Beobachtung des (immer bedrohlich erscheinenden) Nachthimmels zurück, sondern auch auf die Beschäftigung mit Rasterpunkten voraus. Er nutzte sie einerseits, um Bildflächen dreidimensional zu strukturieren, anderseits aber auch, um sie in Form ausgestanzter Löcher zum Lichtmalen zu nutzen.
 Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)
Am Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre begann sich die Avantgarde zu vernetzen, und Düsseldorf war eines ihrer Zentren: 1959 eröffnete Otto Piene seine erste Einzelausstellung, auf der er Rasterbilder und Rauchzeichnungen zeigte und sein «archaisches Lichtballett» aufführte».Ab 1961 sorgte Joseph Beuys als Professor der Kunstakademie mit ersten Happenings und im Februar1963 mit einem internationalen FLUXUS-Fest für Aufsehen. Mit dabei war damals auch Daniel Spoerri, mit Jean Tinguely einer der Begründer der Bewegung des Nouveau Réalisme, zu der die ZERO-Bewegung früh Beziehungen pflegte, wie ein Bild aus dem Jahr 1959 von der Vernissage der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Antwerpener Hessenhuis belegt. (Zu sehen sind Margaret und Heinz Mack und Otto Piene, daneben Jean Tinguely und Daniel Spoerri, Pol Bury, Yves Klein und Emmett Williams.)
Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.
Experiment» die «Sky Art». 1972 entstand für die Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in München der «Olympische Regenbogen». In späteren Jahren entwickelte sich die Idee, ganz im Sinn des CAVS-Konzepts, zu mannigfaltigen Interventionen mit zum Teil riesigen luftgefüllten Ballonskulpturen in der Landschaft. (Die Verwandtschaft mit einzelnen von Christos Projekten wäre vielleicht einer näheren Betrachtung wert.) Pienes Arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wo ihm sein Düssledorfer Atelier immer zur Verfügung blieb, zeigten im Lauf der Jahre eine grosse Vielfalt. Gemeinsam blieb ihnen, dass sie in ihrer grossen Mehrheit den öffentlichen Raum bespielten. Die in der Ausstellung gezeigten «Fleurs du Mal» oder auch die «Lichtblumen» gehören zu den Ausnahmen. So eindrücklich sie sind, können sie die Wirkung der Openair-Skulpturen – neben den bereits erwähnten – zum Beispiel, besonders eindrücklich, die «Black Stacks Helium Sculptures», die am 30. Oktober 1976 in Form von 90 Meter hoch in den Himmel ragenden heliumgefüllte Polyethylen-Schläuche über den vier Kaminen der Southeast Steam Plant in Minneapolis schwebten. (Das Basler Publikum kennt die Bilder bereits aus der Ausstellung «Territories of Waste», die – ebenfalls kuratiert von Sandra Beate Reimann – vom 14.9.2022 bis 8.1.2023 zu sehen waren.) Nun werden auch die Ideenskizzen Pienes zu diesem spektakulären Projekt gezeigt. Das ist nur ein Beleg dafür, wie fruchtbar sich die Zusammenarbeit der Basler Kuratorin mit ihrer amerikanischen Kollegin Lauren Hanson, einer eminenten Kennerin von Pienes gezeichnetem Ideen-Fundus, auswirkte.
 Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.
Der umfassende Ansatz ermöglicht dem Publikum auf dem Ausstellungsparcours immer wieder Déjà-Vu-Begegnungen. So übertrug der Künstler das Konzept der Rasterbilder vom Ende der 1950er-Jahre 1973 auf den Entwurf zur Fassadengestaltung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Münster. Ein anderes Motiv, Ikarus’ Traum vom Fliegen und sein Sturz in den Tod, ist in mannigfacher Form im Werk Pienes präsent: in Zeichnungen aus den 1970er- und 1980er-Jahren, aber auch in verschiedenen Happenings, bei denen Piene zum Beispiel am 9. Januar 1969 für einen lokalen TV-Sender in Boston unter dem Titel «Manned Helium Sculpture» ein Lichtballett inszenierte, bei dem die 17jährige Susan Peters an Helium-Ballons 13 Meter hoch am Nachthimmel schwebte. Eine Weiterentwicklung dieses Konzepts war 1982 der – später auch andernorts gezeigte – «Sky Event», bei dem die Cellistin Charlotte Moorman, angegurtet und und durch Hilfskräfte gesichert, 30 Meter über dem Boden auf ihrem Instrument atonale Improvisationen zum Besten gab.
Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.
Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:
Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.
Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpl, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9


Bei allen Verschiedenheiten waren sich die jungen Künstlerinnen und Künstler einig, dass die Kunst in die Öffentlichkeit gehört – ganz im Sinne der Gruppe ZERO im Streben nach einer besseren Welt. 1964 übernahm Otto Piene in Philadelphia eine Gastprofessur, und ein Jahr später zog er weiter nach New York. 1968 etablierte Piene, inzwischen Direktor des »Center for Advanced Visual Studies (CAVS)» auf einem Sportfeld des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge mit dem «Light Line


Insgesamt ist der Rückblick auf Otto Piene und sein Werk als eine überaus gut gelungene Hommage zu werten. Das betrifft sowohl das Konzept, das gesamte Werk in seiner Vielfalt darzustellen, als auch das Bestreben, die thematischen Kontinuitäten – unter anderem anhand der Skizzenbücher – sichtbar zu machen.
Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter zweisprachiger Katalog mit einem ausführlichen biografischen Teil sowie Aufsätzen der Kuratorinnen und anderen Expertinnen:
Lauren Elizabeth Hanson (Hrsg. für Das Museum Tinguely, Basel): Otto Piene – Wege zum Paradies/Paths to Paradise. Basel/München 2024 (Hirmer Verlag), 288 Seiten, €49.90
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.
Illustrationen (von oben): Otto Piene, Lichtraum mit Möchengladbachwand (1963-2013), Otto Piene Estate, Courtesy Sprüth Magers, ©Pro Litteris, Zürich, 2024. Eröffnung der Ausstellung «Vision in Motion – Motion in Vision» im Hessenhuis, Antwerpen 1969, ©bpl, Foto Charles Wilp. Otto Piene, Testinstallation Olympischer Regenbogen, 1972, St. Paul, MN, USA, 1. Augsut 1972, ©Pro Litteris, Zürich, Otto Piene Estate, Foto: Jean Nelson, Otto Piene Archiv. Otto Piene: Untitled (bleed-through of previous page, left page); Untitled (fall of Icarus, right page), Harvard Art Museums/Busch-Resinger Museum, Schenkung von Elizbeth Goldring Piene ©2024 Pro Litteris Zürich, Otto Piene Estate, Foto © President and Fellows of Harvard College 2019.35.9
Delphine Reist im Museum Tinguely
19.10.23 15:23
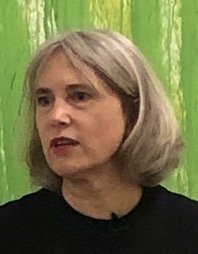

Illustrationen: Porträt Delphine Reist (Foto ©Jürg Bürgi, 2023); «La pente (das Gefälle), 2023 (Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi)
Temitayo Ogunbiyi im Museum Tinguely
19.10.23 15:02



P.S. «Agbalumo» heisst in der Sprache der Yoruba eine afrikanische apfelförmige Frucht (Gambeya albida), der mannigfaltige Heilkräfte zugesprochen werden. Wie daraus Wein wird, ist uns nicht bekannt. Hingegen gibt es im Internet Rezepte für Mango-Wein (https://fruchtweinkeller.de/rezepte/mangowein/).
Illustrationen von oben nach unten: Temitayo Ogunbiyi vor ihrer Installation «You will follow the Rhein and compose play» im Solitude Park, 2023. © Museum Tinguely, Foto: Matthias Willi; «Healing Verb», 2023. © Courtesy of the artist. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi. «You will follow the Rhein and compose play (instrument), 2023. Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi.
Niko Pirosmani in der Fondation Beyeler
16.09.23 16:01




S. Keller und D. Baumann (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Niko Pirosmani. Berlin 2023 (Haje Cantz Verlag), 208 Seiten, CHF 62.50/€ 58.00.
Illustrationen: Porträt des Fotografen Eduard Klar. © Infinart Foundation/George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation. (Es ist zweifelhaft, ob dies tatsächlich das einzige Konterfei Pirosmanis ist. Der Wikipedia-Text https://de.wikipedia.org/wiki/Niko_Pirosmani zeigt das Bild eines bartlosen, jüngeren Mannes.) «Fischer», «Giraffe», «Fest des heiligen Georg in Bolnissi» (Foto aus der Ausstellung) © Infinitart Foundation.
Matisse, Derain und ihre Freunde im Kunstmuseum Basel
01.09.23 17:53



Illustrationen von oben nach unten: Henri Matisse «La Plage rouge», 1905 (Scan aus dem Katalog); Henri Matisse «Nu aux souliers roses», 1900 (Scan aus dem Katalog); André Derain «La danse», 1906 (Privatsammlung, © 2023, Pro Litteris, Zürich).
Die Ausstellung wird begleitet von einem sorgfältig gestalteten Katalog mit kenntnisreichen Aufsätzen, die den didaktischen Anspruch der Ausstellung unterstreichen,
auch ökonomische und soziale Aspekte des französischen Kunstschaffens zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzubeziehen.
Fink, A., Grammont, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Matisse, Derain und ihre Freunde. Die Pariser Avantgarde 1904-1908. Basel/Berlin 2023 (Kunstmuseum Basel/Deutscher Kunstverlag), 266 Seiten, €58.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
«Out of the Box» zum Schaulager-Jubiläum
10.06.23 16:32
Vom 10. Juni bis zum 19. November 2023 zelebriert das Schaulager der Laurenz-Stiftung in Münchenstein mit der von Heidi Naef kuratierten Ausstellung «Out of the Box» sein 20-Jahre-Jubiläum. Zu sehen sind 90 Werke von 25 Künstlerinnen und Künstlern. Für die zahlreichen «zeitbasierten Medienwerke», wie Maja Oeri, die Präsidentin der Laurenz- und der Emnauel-Hoffmann-Stiftung, die Videoarbeiten im Vorwort des Ausstellungshefts nennt, wurden im Erd- und im Untergeschoss grosszügige Projektionsräume eingerichtet. So durchwandert das Publikum eine vielgestaltige Landschaft von Boxen und stösst in den Gängen und auf Plätzen dazwischen auf traditionelle Kunstwerke – Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen. Das Schaulager nutzt das Jubiläum, um in der ersten Ausstellung seit langem neu erworbene Werke zu präsentieren und gleichzeitig mit Arbeiten aus dem Sammlungsbestand zu dokumentieren, dass die Emanuel Hoffmann-Stiftung mit ihren Ankäufen keinem kurzlebigen Hype nachrennt. In der Tat wird offensichtlich, dass hier Künstlerinnen- und Künstler-Karrieren über Jahre begleitet und unterstützt werden.
 So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.
So ist es kein Zufall, dass zum Beispiel die Schwedin Klara Lidén (geb. 1979) mit vier neueren Werken vertreten ist. In drei Videoarbeiten tritt sie selbst in körperlich anstrengenden Rollen in Erscheinung, besonders witzig im kurzen Videoclip «Out to Lunch» (2018), in dem sich in einer blitzblanken Küche plötzlich die Kühlschrank öffnet und sich eine Person daraus hervorwindet. In einer weiteren (kompelexeren) Arbeit, «Closer Now» (2022), rollt die Künstlerin in Purzelbäumen die steile und enge Rue Barbaroux in Marseille hinunter. Der Film läuft in einem Raum, in dem sich auch drei von einem Discokugelmotor angetriebene Kartonschachteln unterschdiedlicher Grösse um die eigene Achse drehen. Wie im Ausstellungsheft zu lesen ist, entsprechen die drei Boxen, aufeinander gestapelt, der Körpergrösse der Künstlerin. Und die kreisende Bewegung nimmt Bezug auf den schmerzhaften Parcours auf der abschüssigen Gasse.
 Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.
Einen prominenten Auftritt hat auch die Engländerin Tacita Dean, die mit einem Video und zwei riesigen Malereien vertreten ist, welche das Bühnenbild und die Kostüme für das Tanzstück «The Dante Project» des Royal Opera House in London zeigen. Dean nutzte für die Darstellung der drei Teile der «Göttlichen Komödie» – «Inferno», «Purgatory (Threshold)», «Paradise» – ihre profunden Kenntnisse der Maltechnik, der Fotografie und der Videokunst.
Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus, wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!
wobei die Grifflöcher die Fenwsteröffnungen bestimmten. Dann schnitt und klebte er aus den Papperesten die Kirchen, anschliessend aus den Resten die Einfamilienhäuser, gross und klein, und schliesslich aus dem Abfall die Ruinenlandschaft. Recycling auf die Spitze getrieben, ein neues (und schöneres) Leben für banale Bananenboxen!
Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.
Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein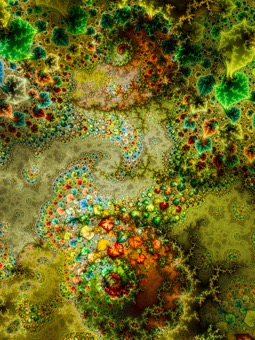 komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.
komponierte Stück «Concerto pour la main gauche» aus dem Jahr 1930 simultan von zwei Pianisten dargeboten. Die einzeln aufgezeichneten und simultan abgespielten Videos zeigen, wie die linken Hände der Klaviervirtuosen kraftvoll über die Tastaturen ihrer Instrumente tanzen. Raffiniert auf durchsichtige Leinwände projiziert, sieht man die ganze Zeit die Hände der beiden Musiker, welche die Partitur individuell interpretieren, mal im Gleichklang mal mit minimalem zeitlichem Abstand, während die Tonspuren neben den Klavierklängen auch die des begleitenden Orchesters wiedergeben.
Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.
Boxes» befasst sich mit Verpackungen unserer Wegwerfgesellschaft. Die 13 namenlosen Behältnisse, die auf Sockeln im freien Raum präsentiert werden, sehen aus, als wären sie aus Blech oder Plastik. In Wirklichkeit hat sie der Künstler aus Pappe und Papier gefertigt und täuscht die Betrachtenden durch eine raffinierte Bemalung.
Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.
Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.
Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.
Doppeltürme aus aufeinander gestapelten Schokolade- und Zuckergussbüsten. Sie kamen 1989 als Work in progress in die Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung. Das von Peter Fischli gestaltete Buch dokumentiert in Texten und mit über 1000 Fotos die Geschichte des überaus anspruchsvollen Ankaufs, bei dem von Anfang an klar war, dass das Werk über kurz oder lang durch Insektenfrass und Fäulnis dem Verfall geweiht ist. Es befindet sich in einem eigens dafür eingerichteten Atelierraum, den der Künstler bis kurz vor seinem Tod benutzte.
Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00
Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.


Zu den Entdeckungen der Ausstellung gehören die Arbeiten des in Zug lebenden und arbeitenden Baslers Jean-Frédéric Schnyder (geb. 1945). Die ausgestelltenWerke «Handle With Care», «Reuse of this Box is Prohibited – by Law», «Do Not Drop or Turn Upside Down» und «Keep at 54°F or 14°C» sind, wie es die Titel vermuten lassen, aus gebrauchten Bananenschachteln gefertigt. Schnyder, lernen wir aus dem erläuternden Text, konstruierte aus den Kartons zuerst ein Hochhaus,

Ebenfalls neu und überraschend sind die Arbeiten von Thomas Ruff (geb. 1958). Für seine faszinierend farbigen, digital generierten mathematischen Strukturen, sogenannte Fraktale, erfand der deutsche Künstler eine überzeugende Darstellungsform. Anstatt als Abzüge auf Fotopapier, die der Farbpracht der Konstruktionen nicht gerecht werden konnten, machte er sich neue Möglichkeiten des Teppichdrucks zunutze. «D.o.pe», der Titel seiner Arbeiten, die alle zwei Meter breit und 267 Zentimeter hoch sind, nimmt Bezug auf den Essay «The Doors of Perception» («Pforten der Wahrnehmung»), in dem Aldous Huxley 1954 seine Erfahrungen mit dem Halluzinogen Meskalin beschrieb.
Besondere Beachtung verdient auch das Werk «Ravel Ravel Interval» des albanischen Künstlers Anri Sala (geb. 1974). In einem besonders für die Aufführung konstruierten Raum mit reduzierter Schallreflexion wird das von Maurice Ravel (1875-1937) im Auftrag des kriegsversehrten, einarmigen, österreichischen Pianisten Paul Wittgenstein
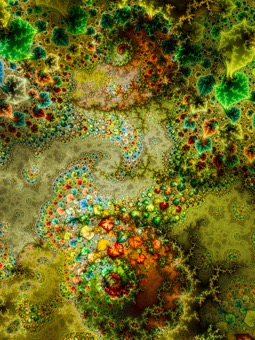
Zu den sicheren Werten im Schaulager gehören seit langem die Arbeiten von Peter Fischli und David Weiss, deren Projektion von 405 ebenso banaler wie irritierender Fragen («Ohne Titel», 1981-2003) – «Weiss ich alles über mich?», «Fährt noch ein Bus?» – in beispielhafter Weise das von Humor und Nachdenklichkeit geprägte Werk des Künstlerduos repräsentiert. Peter Fischli, der seit 2012, nach dem Tod von Peter Weiss, eigenständig weiter arbeitet, ist mit zwei neueren Werken vertreten: «Cans, Bags and

Es ist unmöglich, im Rahmen dieses Berichts alle Stationen des Ausstellungsrundgangs zu würdigen. Er führt auch an Werken vorbei, die wir schon anlässlich früherer Ausstellungen beschreiben konnten – zum Beispiel die Werkschauen 2008 von Andrea Zittel und Monika Sosnowska oder 2016 Arbeiten von Katharina Fritsch (mit Alexej Koschkarow) – und er endet unweigerlich bei Dieter Roth (1930-1998), der das Schaulager 2003 mit der grossen Retrospektive «Roth-Zeit» eröffnete. Jetzt sind von dem Universalkünstler einige seiner ikonischen Schokoladen-Skulpturen, darunter eine «Vogelfutterbüste» von 1968 und der «Grosse Schokoladenzwerg» von 1971, zu sehen. Im Zentrum aber steht das Alterswerk «Solo Szenen», eine Art subversives Memento Mori, das auf 128 Monitoren den Menschen Roth bei banalsten alltäglichen Verrichtungen vorführt.
Dem Schaulager ist mit «Out of the Box» eine grossartige Jubiläumsschau gelungen. Es lohnt sich, für dieses einzigartige und auch anspruchsvolle Angebot, die nötige Zeit aufzuwenden und das Angebot zu nutzen, dass Tickets für drei Besuche gültig sind.
Als besonderes Highlight zum Jubiläum publizierte das Schaulager unter dem Titel «Dieter Roth Selbstturm; Löwenturm» eine monumentale Darstellung über Roths

Laurenz-Stiftung, Schaulager Basel (Hrsg.): «Dieter Roth, Selbstturm; Löwenturm» Peter Fischli (Bildkonzept), Maja Oeri (Vorwort), Andreas Blättler, Marcus Broecker, Tom Bisig/Lea Brun und Isabel Friedli (Texte) Münchenstein/Köln (Laurenz-Stiftung/Schaulager; Verlag der Buchhandlung Walther König) 240 Seiten, CHF 59.00
Illustrationen von oben nach unten: Klara Lidén: «Out to Lunch», 2018 HD Video, Farbe, Ton, 0:22 Min., Ed. 1/3 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Klara Lidén. Tacita Dean: «Inferno», 2019 (Detail) Kreide auf Masonit, 242 × 1219 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Stephen White and Co, Courtesy the artist and Frith Street Gallery © Tacita Dean. Jean-Frédéric Schnyder: «Handle with care», 2012 Karton von Bananenschachteln, Klebeband, 12 Kirchen, diverse Masse, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, 2023. ©Jean-Frédéric Schnyder. Thomas Ruff: «d.o.pe. 01», 2022 Colaris Teppichdruck, 267 × 200 cm, Ed. 2/4 + 1 AP, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: David Zwirner, New York, 2022, © 2023, ProLitteris, Zurich. Peter Fischli: «Untitled», 2019 Aus der Serie «Cans, Bags & Boxes», Karton, Zeitungspapier, Emaillelack, 121 × 23.2 × 23.2 cm, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel, © Peter Fischli.
Janet Cardiff und George Bures Miller im Museum Tinguely
05.06.23 18:56
Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff (geb. 1957) und George Bures Miller (geb. 1960) arbeitet seit 30 Jahren gemeinsam an interaktiven Installationen, die Musik, Film und Theater mit einander verbinden. Das Werk von Jean Tinguely bezeichnen sie als eine ihrer wichtigsten Inspiratationsquellen. Logisch, dass das Museum Tinguely das Schaffen des Künstlerpaars (in Zusammenarbeit mit dem Lehmbruck Museum in Duisburg und kuratiert von Roland Wetzel) erstmals in der Schweiz in einer grossen Übersichtsausstellung präsentiert. Vom 7. Juni bis zum 24. September sind unter dem Titel «Dream Machines» ein gutes Dutzend ihrer raffinierten Erfindungen in Basel zu erleben.  Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.
Ein Erlebnis bietet die Ausstellung, weil sie nicht nur alle Sinne anspricht, sondern weil das Publikum durch die Präsenstation in oft dunklen oder halbdunklen Räumen gezwungen wird, sich ganz auf die einzelnen Exponate zu konzentrieren.
In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.
 Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.
Um einiges elaborierter geschieht das Mitmach-Mixen mit dem «Melloton», einem in den 1960er-Jahren als technisches Meisterstück entwickelten analogen Sampler, der auf Tastendruck auf Magnetband gespeicherte Tonschnipsel abspielte. Die BBC verwendete solche Geräte, um jederzeit Jingles oder O-Töne zur Verfügung zu haben. Cardiff/Miller belegten die 72 Tasten des klavierähnlichen Manuals mit diversen Soundbytes, die sie mit farbigen Präge-Etiketten kenntlich machen. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne oder mehrere Musikinstrumente zu spielen und Alltagsgeräusche dazu zu mischen.
Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.
 Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».
Der Parcours durch die Ausstellung entfaltet das ganze Spektrum der künstlerischen Interessen von Janet Cardiff und George Bures Miller. darunter sind hochkomplexe Installationen wie «Opera for a small Room» von 2005. Wir sehen von aussen durch verschiedene Öffnungen in das Refugium eines Opern-Enthusiasten. Es ist vollgepackt mit Vinyl-Platten, Plattenspielern und Lautsprechern. Lichteffekte und Geräuschen begleiten das Abspielen von Opernmusik. Das Werk entstand nach dem Fund einer grossen Zahl von Schallplatten in einem Trödelgeschäft, die alle mit R. Dennehy, dem Namen des Besitzers, versehen waren. Anstatt diesen Royal Dennehy mithilfe eines Telefonbuchs ausfindig zu machen, verwendete das Künstlerpaar die Spuren auf der Plattensammlung und rekonstruierte daraus eine fantastische 12-Quadratmeter-Klause des Opern-Enthusiasten irgendwo in einem Kaff in British Columbia. Die Abfolge der Tonbeispiele erzählt, wie es im Saaltext heisst, «eine traumartige Handlung in verschiedenen Akten und macht Dennehys unsichtbare Präsenz im Raum spürbar».
Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.
Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.
sind. Bewegungsmelder an den Tischseiten lösen diverse Toneffekte aus, wenn sich jemand nähert. Je nach Position und Bewegungsgeschwindigkeit ergibt sich eine vielgestaltige Komposition in F-Moll. «Je mehr Menschen interagieren», heisst es in der Erläuterung zu dem Werk, «desto lauter und unübersichtlicher wird das Arrangement». Auch ein besonders elaboriertes und besonders kleinformatiges Kunst-Stück verdient es, speziell erwähnt zu werden. Es heisst «Sad Waltz And The Dancer Who Couldn’t Dance» von 2015 und ist eine Art Puppenstuben-Stück mit einer Klavier spielenden und einer tanzenden Marionette. Der Pianist intoniert den «Traurigen Walzer» des Komponisten Edward Mirosján und die Balletteuse, deren Fäden von einer über ihr hängenden komplexen Steuerung gezogen werden, bemüht sich Schritt zu halten. Dummerweise verheddern sich ihre Fäden und sie wird von der Apparatur in die Höhe gezogen. Hilflos rudert sie sich frei und nach einigen Momenten der Ungewissheit, steht sie wieder auf dem Boden und führt die Choreografie zu Ende.
Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.
Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).

In vielen Fällen erzählen die Installationen eine eigene Geschichte oder sie dokumentieren einen kreativen Prozess der Künstlerin und des Künstlers. Die Saaltexte, die jedes der Werke begleiten, geben ausführlich darüber Auskunft. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein im Tageslicht platziertes Schubladenmöbel früher die längst obsoleten Katalogkarten einer Bibliothek enthielt. Was aber weiter für dieses «Cabinet of Curiousness» gilt, ist die Neugier, die es anstachelt. Das Publikum ist aufgefordert, ihr nachzugeben und einzelne Schubfächer zu öffnen: Sie enthalten Klänge, ganze Musikstücke oder gesprochene Texte, alles, wie Janet Cardiff beim Rundgang mit den Presseleuten berichtete, Trophäen eigener Tonjägerei. Wer mehrere Schubladen zieht, mischt die Tondokumente nach Art eines DJ.

Eine ganz andere, nämlich eine magische Dimension spricht das Werk «To Touch» von Janet Cardiff aus dem Jahr 1993 an: Im dunklen Raum steht ein massiver Holztisch, der das Publikum animiert, mit der Hand über die Oberfläche zu streichen. Wie durch Zauberei ertönen dabei Geräusche oder menschliche Stimmen. Und wenn mehrere Hände über die Tischplatte streichen, entsteht ein vielgestaltiger Tonteppich. Im Gegensatz zum Mellotron gibt es hier nichts zu steuern oder vorauszusehen: alles ist Zauberei.

Wie das Beispiel zeigt, lassen sich Janet Cardiff und George Bures Miller für viele ihrer Arbeiten durch eigene Erlebnisse oder die Öffentlichkeit beschäftigende Ereignisse anregen. Es ist ihre Kunst, dies so zu tun, dass Werke über den Tag hinaus ihre Gültigkeit behalten. Beispielhaft gilt dies für «The Killing Machine» von 2007, die, im Kontext des Folterskandals im irakischen US-Gefängnis von Abu-Ghraib entstanden und angelehnt an Franz Kafkas Erzählung «In der Strafkolonie», die Abgründe automatisierter Grausamkeit thematisiert. Auch die Auswirkungen der Pandemie finden im Werk von Cardiff/Miller ihren Niederschlag: 2021 konstruierten sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen «Escape Room» als (inzwischen wieder verlassene) Werkstatt voller unvollendeter Arbeiten. Unter den Szenerien gibt es eine Kathedrale und ein Hochhaus, eine Fabrik und ein Hafenviertel. Die Beleuchtungen sind eingeschaltet, die Pläne und Werkzeuge liegen daneben bereit. Wer sich zwischen den einzelnen Elementen bewegt, löst Licht und Toneffekte aus. Die Menschen, die hier gewöhnlich auf engem Raum zugange sind, haben offenbar Reissaus genommen. Über allem liegt der Geruch der Dystopie, der allerdings durch zahlreiche witzige Details gebrochen wird.
Witz und ironische Distanz gehören zum künstlerischen Instrumentarium des Künstlerpaars. Besonders gut gefallen hat uns in dieser Hinsicht das Werk «Experiment in F#Minor» von 2013. Dabei handelt es sich um einen – wiederum magischen – Tisch, auf dem nicht weniger als 72 Lautsprecher verschiedener Grösse und Form platziert

Nicht im Museum Tinguely, sondern in der Druckereihalle im Ackermannshof an der St. Johanns-Vorstadt 19/21, ist ab 1. Juli die Installation «The Forty Part Motet» von Janet Cardiff zu sehen und zu hören. Das Publikum hört die vierzigstimmige Motette «Spem in Alium» (Hoffnung auf einen Anderen), des englischen Barock-Komponisten Thomas Tallis aus dem Jahr 1570. Ursprünglich für acht Chöre zu je fünf Stimmen a cappella komponiert, nahm Cardiff jede der 40 Stimmen einzeln auf und lässt das Stück aus 40 Lautsprechern erklingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich frei im Raum bewegen und sich neben den Lautsprechern auf eine Stimme konzentrieren oder das Chorwerk als Ganzes mitten im Raum geniessen.
Illustrationen: Janet Cardiff und George Bures Miller: «The Cabinet of Curiousness» (2010). ©2023 coutesy the artists, Foto: Museum Tinguely/Matthias Willi (Ausschnitt); janet Cardiff und George Bures Miller: «The Instrument of Troubled Dreams» (2018) © courtesy the artists, Foto Lehmbruck Museum, Duisburg/Thomas Köster. janet Cardiff und George Bures Miller: «Opera for a Small Room» (2005) © courtesy the artists, Luhring Augustine, New York, Gallery Koyanagi, Tokyo, and Fraenkel Gallery, San Francisco, photo: Seber Ugarte, Lorena López. Janet Cardiff und George Bures Miller: «Experiment in F# Minor» (2013), ©2023 Foto aus der Ausstellung (©2023, Jürg Bürgi, Basel).
Roger Ballen im Museum Tinguely: Der Ruf der Leere
18.04.23 16:33




Anlässlich der Ausstellung «Roger Ballen. Call of the Void» erscheint im Kehrer Verlag, Heidelberg, eine englische Publikation mit Texten von Roger Ballen, Andres Pardey und einem Vorwort von Roland Wetzel. Die Publikation ist ab 13. Juni im Museumsshop für 35 CHF erhältlich.
Illustrationen: Porträt Roger Ballen (Ausschnitt) Foto Marguerite Rossouw, © coutesy Marguerite Rossouw). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void» im Tinguely Museum, Basel 2023 (©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Felix Scharff). Installationsansicht in der Ausstellung «Call of the Void», ©courtesy Roger Ballen 2023 Museum Tinguely, Basel; Foto: Marguerite Roussouw. Roger Ballen: «Mouth to Mouth», 2013 ©courtesy Roger Ballen.
Charmion von Wiegand im Kunstmuseum Basel
27.03.23 16:52




Zur Ausstellung, die wegen der Pandemie erst mit Verspätung eröffnet werden konnte, erschien bereits 2021 ein Katalog mit einem grossen Bildteil und kenntnisreichen Textbeiträgen. Wismer, Maja (Hrsg. für das Kunstmuseum Basel): «Charmion von Wiegand. Expanding Modernism», München 2021 (Prestel-Verlag), 200 Seiten CHF 44.00.
Illustrationen (von oben nach unten): Arnold Newman: Porträt von Charmion von Wiegand, 1961 (Scan aus dem Katalog); Titelblatt des Magazins «New Masses» 1926 (aus Wikipedia); Charmion von Wiegand: The Great Field of Action or the 64 Hexagrams (Der Altar der Ahnen aus dem I Ging), 1953. (Collection Walker Art Center, Minneapolis, Schenkung Howard Wise, New York, 1974); Charmion von Wiegand: Triptych, Number 700. 1961 (Whitney Museum of American Art. Schenkung Alvin M. Greenstein.)
Shirley Jaffe im Kunstmuseum Basel
25.03.23 16:45

,
dessen Atelier in Arcueil sie zeitweise benützen konnte. Ihre frühen Bilder sind stark vom Impressionismus im Spätwerk von Claude Monet (1840-1926) beeinflusst, das zuvor schon dem amerikanischen abstrakten Expressionismus von Jackson Pollock (1912-1956) und Willem de Kooning (1904-1997) auf die Sprünge geholfen hatte. Auffallend in der ersten künstlerischen Schaffensperiode sind die grossen Formate ihrer Bilder. Der abstrakte Expressionismus verlangt nicht nur beim Malen die grosse Gestik, er muss auf einen dominanten Auftritt haben. Neben Sam Francis, der ihr den Kontakt vermittelte, wurde in den 1950er Jahren der grosse Schweizer Kunst-Anreger Arnold Rüdlinger die wichtigsten Stütze für Jaffes frühe Karriere. Rüdlinger (1919-1967), von 1946 bis 1955 Leiter der Kunsthalle Bern und anschliessend, bis zu seinem frühen Tod, der Kunsthalle Basel, ermöglichte ihr 1958, zusammen mit Kimber Smith und Sam Francis, einen Gruppenauftritt am Steinenberg. im gleichen Jahr kuratierte er im Pariser «Centre Culturel Américain» in gleicher Zusammensetzung eine Ausstellung. Er war fasziniert vom «gänzlich uneuropäischen Raumgefühl, das auf ein Zentrum, eine Perspektive und auf harmonische Proportionen verzichtet», wie er im Katalog schrieb. (Zur Erinnerung: 1957, zwei Jahre bevor die Berner Galerie Klipstein und Kornfeld Shirley Jaffe ihre erste Einzelausstellung ausrichtete, hatten Arnold Rüdlinger und Ebi Kornfeld (1923-2023) in den USA mit einem Kredit der National-Versicherung für das Kunstmuseum Basel Werke von Franz Kline, Barnett Newman, Mark Rothko und Clyfford Still gekauft. Nirgendwo sonst in Europa war die zeitgenössische amerikanische Kunst so prominent vertreten. Klar, dass sich das brave Publikum entsprechend provozieren liess…) Um 1960, heisst es in einem Abschnitt der Saaltexte zur Ausstellung, «war der abstrakte Expressionismus bereits (Kunst)Geschichte». Viele aus der Pariser Expats-Kolonie kehrten in die USA zurück und entwickelten dort neue, eigene künstlerische Positionen. Auch Shirley Jaffe beobachtete, dass sich ihre Malerei veränderte. Sie lebte getrennt von ihrem Ehemann; 1962 liess sich das Paar scheiden. Im Jahr darauf nutzte sie die Gelegenheit, mit einem Stipendium der Ford Foundation in Berlin zu arbeiten. Der Aufenthalt in der Stadt an der Frontlinie des Kalten Krieges, noch schockiert vom Bau der Mauer im August 1961 und auch im Westteil noch keineswegs trümmerfrei, hinterliess tiefe Spuren in Shirley Jaffes künstlerischer Biografie. Das Begleitprogramm der Stiftung ermöglichte ihr, sich mit dem deutschen Expressionismus bekannt zu machen und die Avantgarde, darunter der griechisch-französische Komponist, Musiktheoretiker und Architekt Iannis Xenakis und der Pionier der elektronischen Musik, Karlheinz Stockhausen, kennen zu lernen. 


Zur Ausstellung in Basel erschien eine eigene, auf dem Katalog des Centre Pompidou aufbauende deutsch-englische Publikation. Olga Osadtschy, Frédéric Paul (Hg. für das Kunstmuseum Basel): «Shirley Jaffe, Form als Experiment/Form as Experiment», Basel 2023 (Christoph Merian Verlag), 296 Seiten, CHF 49.00.
Eine ausführliche Besprechung unter Berücksichtigung der Katalog-Essays erscheint demnächst hier.
Illustrationen von oben nach unten: Atelier von Shirley Jaffe, Paris, 13. Oktober 2008 (Kunstwerk im Hintergrund: Bande dessinée en Noir et Blanc, 2009. ©Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou/Jean-Christope Mazur; ©2023, ProLitteris, Zürich. Shirley Jaffe: Arceuil Yellow, 1956 Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, um 1965. Centre Pompidou, Paris © ProLitteris, Zürich. Foto Centre Pompidou (Audrey Laurans). Shirley Jaffe: Ohne Titel, 1968. Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. Foto ©Bernard Huet/tutti image.
«À bruit secret»: Der Hörsinn im Museum Tinguely
23.02.23 14:47
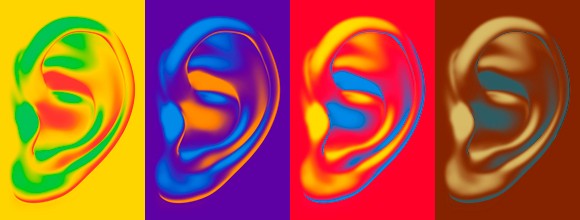

Für seine raumgreifende (und zum ersten Mal in der Schweiz ausgestellte) Installation «Oracle» von 1962/1965 liess Rauschenberg zum Beispiel von Billy Klüver (der 1960 Jean Tinguely geholfen hatte, die sich selbst zerstörende Skulptur «Homage to New York» zu bauen) und seinem Ingenieurkollegen Harold Hodges in jedes der fünf Elemente

Sind in den ersten Räumen der Ausstellung, die sich über ein Dutzend Stationen auf drei Stockwerken des Museums erstreckt, grosso modo die erwartbaren Artefakte zu sehen, so wartet die Kuratorin im weiteren Verlauf des Parcours mit zahlreichen Überraschungen auf. Sie zeigt, wie in den zahlreichen jüngeren Arbeiten die Kunst mit einer

Auch Dominique Koch (geb. 1983 in Luzern) nutzt naturwissenschaftliche Forschung für ihre künstlerische Arbeit. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Musiker und Komponisten Tobias Koch, machte sie im Erdreich von La Becque am Genfersee mit Spezialmikrofonen Aufnahmen von gewöhnlich unhörbaren Geräuschen. Anschliessend materialisierte sie das bioakustische Material in einer Glaswerkstatt zu zufällig geformten Artefakten, indem sie den durch die Schallwellen erzeugten Luftdruck zum Glasblasen verwendete. So erstarrten flüchtige Töne und Geräusche zu festen, dauerhaften «Sound Fossils».

Zwei weitere Arbeiten, die wässerige Klanglandschaften erlebbar machen, haben uns besonders beeindruckt: Christina Kubisch (geb. 1948 in Bremen), auch sie musikalisch und künstlerisch ausgebildet, installierte eigens für die Ausstellung ihre Arbeit «Il reno», eine 12-Kanal-Komposition mit Tonaufnahmen, die sie in Basel mit Unterwassermikrofonen an verschiedenen Orten im Rhein gemacht hat. Gleich zu Beginn der Ausstellung erhält das Publikum Gelegenheit, per Induktionskopfhörer diese

Das zweite besonders eindrückliche Werk ist das letzte der Ausstellung: Auf einem Tisch liegt ein Buch mit Anweisungen des Künstlers Cevdet Erek (geb. 1974 in Istanbul), so mit kreisenden Handbewegungen über den an der Wand hängenden Teppich zu streichen, dass dabei das Geräusch von Meereswellen evoziert wird. Die ganz einfache, auf den ersten Blick irritierende Installation ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit, mit einem Kunstwerk ein subjektives künstlerisches Erlebnis zu schaffen, das ohne Mitwirkung des Publikums nicht zustande käme.
Die Fülle der Eindrücke, welche die Ausstellung «À bruit secret» für die Besucherinnen und Besucher bereit hält, ist mit diesen wenigen Beschreibungen nicht erschöpft. Es gibt sehr viel zu sehen und zu hören. Die Künstlerinnen und Künstler stellen mit ihren Werken viele Fragen. Es lohnt sich, sich für sie Zeit zu nehmen, auch wenn viele nicht gültig zu beantworten sind. Hilfreich sind die ausführlichen Saaltexte, die hier auch als PDF zur Verfügung stehen.
Illustrationen: Ausstellungsbanner (Website des Museums). Marcel Duchamp: «À bruit secret» ©Association Marcel Duchamp/2023 ProLitteris, Zürich. Robert Rauschenberg: «Oracle». Robert Rauschenberg Foundation/2023 ProLitteris, Zürich. Marcus Maeder:«Espirito da floresta/Forest spirit Florest» Courtesy of the artist/2023 ProLitteris, Zürich. Ursula Biemann: «Acoustic Ocean» Installationsansicht (Ausschnitt) ©Ursula Biemann; Foto: Margot Montigny. Christina Kubisch: «Il reno». Installationsansicht Museum Tinguely. ©Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr.
Museum Tinguely: Die Sammlung
08.02.23 14:57


Illustrationen: Jean Tinguely bei Materialsuche, Paris 1960 (Ausschnitt, Fotograf unbekannt); Jean Tinguely «Èloge de la Folie», 1966 (© Museum Tinguely, Basel, Foto: Daniel Spehr, Ausschnitt)
Wayne Thiebaud in der Fondation Beyeler
29.01.23 16:45




Zur Ausstellung erschien ein sehr schön gestalteter Katalog mit einem überaus lesenswerten Essay des Herausgebers und Kurators Ulf Küster, sowie dem vollständigen Text eines Interviews mit Jason Edward Kaufman, in dem der hochbetagte Künstler über sein Lebenswerk Auskunft gab. Weitere Beiträge von Janet Bishop und der Assistenzkuratorin Charlotte Sarrazin.
Ulf Küster (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Wayne Thiebaud. Berlin 2023 (Hatje Cantz Verlag), 160 Seiten, CHF 62.50.
Illustrationen von oben nach unten: Wayne Thiebaud (©Wikipedia), «35 Cent Masterworks»,1970-72; «Eating Figures (Quick Snacks)», 1963; Bilder © Wayne Thiebaud Foundation/2022, Pro Litteris, Zurich «Eating Figures» (Detail, Foto Ausstellung © Jürg Bürgi 2023).
Jubiläumsausstellung der Fondation Beyeler
30.10.22 16:36
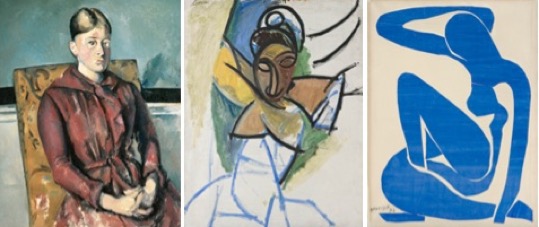

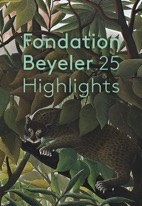
Zur Jubiläumsausstellung erschien auch eine Publikation:
Fondation Beyeler, Bouvier, R. (Hrsg.): Fondation Beyeler. 25 Highlights. Riehen/Berlin 2022 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 80 Seiten CHF 12.00 in der Ausstellung €18.00 im Buchhandel.
Illustrationen, oben von links: Paul Cézanne: Mme Cézanne à la chaise jaune, 1888-1890, Pablo Picasso: Epoque des Demoiselles d’Avignon, 1907 © Succession Picasso/2022, Pro Litteris, Zürich . Henri Matisse: Nu bleu I, 1952 © Succession H. Matisse/2022, Pro Litteris Zürich. alle: Sammlung Beyeler, Fondation Beyeler Riehen, Foto Robert Bayer, Basel. Mitte Duane Hanson: Lunchbreak, 1989 (vorn) und Anselm Kiefer: «Dein und mein Alter und das Alter der Welt», 1997 (Im Hintergrund). Foto aus der Ausstellung, © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Unten: Cover der Ausstellungsbroschüre (Verlagskatalog).
«Zerrissene Moderne» und «Der Sammler Curt Glaser» im Kunstmuseum Basel
27.10.22 17:01
Wie es dazu kam, dass die Öffentliche Kunstsammlung der Stadt Basel kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs den Grundstein für eine der weltweit berühmtesten Kollektionen der Klassischen Moderne legen konnte, zeigt das Kunstmuseum Basel vom 22.10.2022 bis 12.2. bzw. 19.2.2023 in zwei Ausstellungen.
 Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.
Sechs Räume im Untergeschoss des Neubaus sind dem Sammler Curt Glaser (1879-1943) gewidmet, der 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, zuerst seine Stelle als Direktor der Kunstbibliothek in Berlin, später auch seine Pensionsansprüche und seine Staatsbürgerschaft verlor. Noch im gleichen Jahr brachte er einen grossen Teil seiner Wohnungseinrichtung und seiner Kunstsammlung zur Versteigerung. Bei der Auktion erwarb das Kunstmuseum Basel 200 Zeichnungen und Druckgrafiken für das Kupferstichkabinett, darunter bedeutende Werke von Edvard Munch, mit dem Glaser befreundet war. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnten sich der Kanton Basel-Stadt als Eigentümerin der Öffentlichen Kunstsammlung und die Erbengemeinschaft, die zunächst Anspruch auf die Restitution des Konvoluts erhoben hatte, 2020 auf einen Kompromiss einigen. Das Museum anerkannte, dass Glaser seinen Besitz aufgrund der Verfolgung durch das Nazi-Regime veräussert hatte und konnte die 1933 erworbenen Werke behalten. Für Glasers Erben sah die Vereinbarung, die beide Seiten als «gerechte und faire Lösung» akzeptierten, neben einer finanziellen Entschädigung die Zusage vor, das Schicksal des einflussreichen Kunstkenners und Sammlers in einer umfangreichen Ausstellung darzustellen. Dies ist den Kuratorinnen Anita Haldemann, Leiterin, und Judith Rauser, Assistenzkuratorin des Basler Kupferstichkabinetts mit einer klug und kenntnisreich inszenierten Schau in hohem Mass gelungen. Mit Dokumenten und Bildern lassen sie das Leben Curt Glasers, seiner gleichaltrigen Frau Elsa Kolker (1879-1932) und seiner zweiten Gefährtin Maria Milch (1901-1981), mit der er sich nach einem Aufenthalt in Paris noch 1933 in Ascona niederliess, bevor das Paar 1941 über Kuba in die USA emigrierte, Revue passieren. Die Auswahl der ausgestellten Werke beschränkt sich nicht auf die überaus wertvollen 200 Zeichnungen und Druckgrafiken, die das Kunstmuseum 1933 aus Glasers Versteigerung erwarb, sie zeigt vielmehr die ganze Breite der Privatsammlung, die von alten Meistern bis zur Moderne reichte, aber auch ostasiatische, arabische und afrikanische Werke umfasste. Leider war es, wohl aus Platzgründen, nicht möglich, den Bestand von 105 Karikaturen des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808-1879), aus der Sammlung Glaser im Basler Kupferstichkabinett in die aktuelle Ausstellung zu integrieren. Er ist im Hauptbau in den Grafikkabinetten im 1. Stock zu sehen.
Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)
 Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte
Im zweiten Obergeschoss des Neubaus sind alle neun Säle den Ankäufen gewidmet, die es 1939 dem damals neuen Museumsdirektor Georg Schmidt ermöglichten, im drei Jahre zuvor eröffneten neuen Kunstmuseum eine «moderne Abteilung» einzurichten. Die Ausstellung dokumentiert nicht nur die Auseinandersetzungen, die sich in Basel – in der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen – um das Budget für die Neuerwerbungen abspielten, sie zeigt auch, welch verheerende Schäden die Säuberungsaktionen der Nazis in den staatlichen Kunstsammlungen des Deutschen Reiches anrichteten. 1937 wurden rund 21’000 Skulpturen, Gemälde und Arbeiten auf Papier als «entartet» aus deutschen Museen beschlagnahmt. Unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, wurde im Juli 1937 in den Münchner Hofgarten-Arkaden eine Auswahl von 650 Werken aus 32 Museen präsentiert. Zwei Jahre später wählte eine von Joseph Goebbels handverlesene und geleitete Kommission 780 Gemälde und Skulpturen sowie 3500 Arbeiten auf Papier als «international verwertbar» aus. Vier Kunsthändler und das Auktionshaus Fischer in Luzern wurden beauftragt, die Werke an die Meistbietenden zu verkaufen. Das stets am von Zahlungsunfähigkeit bedrohte NS-Regime brauchte dringend Devisen. Georg Schmidt bereitete sich mit der Kunstkommission des Museums sorgfältig auf seine Einkaufstour vor. Er reiste nach Berlin, wo er nicht nur Werke der deutschen und französischen Moderne inspizierte, sondern sich auch Werke zeigen liess, welche die Deutschen nicht für «international verwertbar» hielten. Schmidt war sich der Beschränktheit seiner Mittel und der grossen Konkurrenz bewusst. Zudem musste er sich in einer mehrheitlich bürgerlichen Kunstkommission durchsetzen, die sich wenige Monate zuvor gegen seine Wahl zum Direktor engagiert hatte. Als erstes Werk kaufte  Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.
Schmidt vom beauftragten Kunsthändler Hildebrand Gurlitt für 6000 Franken mit einem Sonderkredit der Basler Regierung «Tierschicksale» von Franz Marc. Etwa die Hälfte der nach heftigen Auseinandersetzungen schliesslich zur Verfügung gestellten 50’000 Franken investierte er in die in Berlin reservierten Werke, die andere Hälfte setzte er während der Luzerner Auktion ein. Für das Basler Kunstmuseum waren die waghalsigen Manöver beim Ausverkauf von 21 Werken «entarteter Kunst» ein einmaliger Glücksfall –zumal sie auch dazu beitrugen, wichtige Kunst-Stücke der Moderne vor der drohenden Zerstörung im Krieg in Sicherheit zu bringen. Allerdings: Für die Arbeiten einer ganzen Generation von jungen Kunstschaffenden, die noch nicht berühmt genug waren, um zu Geld gemacht zu werden, gab es keine Rettung. Sie landeten im Feuer – wie auch die Arbeiten, die bei den Auktionen in Berlin und Luzern übrig blieben.
Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.
Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)
Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung
und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.
Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine inhaltlich umfassende, sehr schön gestaltete Publikation. Haldemann, A. und Rauser, J. (Hrsg.): Der Sammler Curt Glaser. Vom Verfechter der Moderne zum Verfolgten. Berlin 2022 (Deutscher Kunstverlag), 240 Seiten, CHF 38.00. (Eine Broschüre mit Übersetzungen in englischer Sprache liegt bei.)


Die von Eva Reifert, der Kuratorin für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne, und Tessa Friederike Rosebrock, der Leiterin der Provenienzforschung, mit grosser Sachkenntnis und Sorgfalt kuratierte Schau, wird durch eine sehr informative, alle Aspekte des Themas beleuchtende Publikation begleitet.
Reifert, E.; Rosebrock, T. (Hrsg.): Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe «entarteter» Kunst. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 296 Seiten, CHF 54.00 (Die englische Ausgabe trägt den Titel «Castaway Modernism», 344 Seiten, CHF 54.00)
Wir berichten ausführlich und separat über die beiden Ausstellungen und die Kataloge. Die Besprechung der Ausstellung «Curt Glaser» steht hier zur Verfügung
und der Text über die «Entartete Kunst» und die Ankäufe für die moderne Abteilung des Kunstmuseums Basel ist hier nachzulesen.
Illustrationen oben: Elsa und Curt Glaser (Edvard Munch, 1913). Privatsammlung. Foto © Petegorsky / Gipe for Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts. Mitte: Georg Schmidt (ca. 1939). Nachlass Georg Schmidt © Kunstmuseum Basel. Unten: Tierschicksale (Franz Marc, 1913). Kunstmuseum Basel.
Lavanchy-Clarke: Schweizer Filmpionier im Museum Tinguely
19.10.22 16:26

Für die Filmgeschichte von Interesse ist im Leben Lavanchy-Clarkes nur eine relativ kurze Zeitspanne von rund acht Jahren, von 1896 bis 1904. Fasziniert von der Fotografie und von den ersten Verkaufsautomaten, die er zum Vertrieb von Schokolade und Rauchwaren in Bahnhöfen und in den neu aufkommenden Warenhäusern nutzte, kam er mit der Firma der Brüder Lumière in Lyon in Kontakt und erhielt 1896 eine Exklusiv-Lizenz zum Gebrauch ihres neuartigen «Cinématographe» in der Schweiz.Davon machte er


Auch wenn er nicht an Reklame dachte, war Lavanchy-Clarke ein Meister der sorgfältigen Inszenierung. Zu sehen ist das in der Ausstellung an einem Glanzstück der Schweizer Filmgeschichte: Am 16. Mai 1896 dirigierte er bei der Eröffnung der Landesausstellung die berühmtesten Schweizer Künstler vor seine Kamera. Ferdinand Hodler ist da, zusammen mit Albert Welti und Cuno Amiet. Auf weiteren Sequenzen spazieren die Chefs der Landesausstellung und andere Honoratioren im Folklore-Umzug mit. Der 50-Sekunden-Film mit dem Gewimmel des Publikums auf der Mittleren Rheinbrücke in Basel, der im September 1896 gedreht wurde, darf in der Ausstellung natürlich nicht fehlen. Er bildete den Ausgangspunkt der jahrelangen Forschungsarbeit von Hansmartin Siegrist und seinem Team, die schliesslich zur Wiederentdeckung des Belle-Epoche-Genies François-Henri Lavanchy-Clarke führte.

Zur Ausstellung erschien von Hansmartin Siegrist der dokumentarische Kinofilm «Lichtspieler. Wie der geniale Lavanchy-Clarke die Schweiz ins Kino holte».
Als Ausgangspunkt der Forschung über François-Henry Lavanchy-Clarke erhält Hansmartin Siegrists Buch «Auf der Brücke zur Moderne: Basels erster Film als Panorama der Belle Epoque» (Basel 2019, Christoph Merian Verlag) durch die Ausstellung neue Aktualität.
Illustrationen von oben nach unten: François-Henri Lavanchy-Clark mit seinem «Cinématographe» (Ausschnitt) © Fondation Herzog, Basel. «Palais des Fées» an der Landesausstellung in Genf 1896, ©Cinémathèque Suisse, Lausanne. «Les Laveuses» (Filmstill aus der Ausstellung). Die Familie Lavanchy-Clarke, Cannes 1906 ©Fondation Herzog, Basel.
«Territories of Waste» im Museum Tinguely
15.09.22 15:28
Unter dem etwas sperrigen Titel «Territories of Waste. Über die Wiederkehr des Verdrängten» zeigt das Museum Tinguely in Basel vom 14. September 2022 bis zum 8. Januar 2023 wie sich Kunstschaffende weltweit mit dem umweltpolitisch wichtigen Thema des Abfalls auseinandersetzen. Die von Sandra Beate Reimann kuratierte Ausstellung zeigt Arbeiten von 27 Künstlerinnen, Künstlern und Kunstkollektiven. Auf eine Rangordnung oder eine andere Art von rotem Faden habe sie bewusst verzichtet, erläuterte die Kuratorin bei der Präsentation. Die Grösse der skulpturalen Objekte, die Länge der – zahlreichen – Video-Installationen oder die Zeit der Entstehung bieten keine Orientierung. Die Auswahl erscheint damit einigermassen zufällig. Aber Müllberge gibt es überall, Abfall ist allgegenwärtig, und alle Recyclingparks können nicht verhindern, dass die Relikte der menschlichen Zivilisation nicht einfach verschwinden. Einen eindrücklichen Beleg dafür bieten Anca Benera und Arnold Estefán mit ihrer multimedialen Arbeit «The Last Particles» von 2018. Die aus Rumänien stammenden Kunstschaffenden untersuchten den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.
den Sand auf dem Küstenabschnitt «Omaha Beach». Das Gelände, auf dem am 6. Juni 1944, bei der Invasion der Normandie, besonders hart gekämpft wurde, ist bis heute, dem blossen Auge nicht sichtbar, von Metallpartikeln durchsetzt. Neben naturwissenschaftlichen Werkzeugen gehört ein Video zur Installation, auf dem zu sehen ist, wie die Metallteile, magnetisch erregt, eine Art Tanz aufführen.
Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».
der New Yorker Müllabfuhr, dem «New York City Department of Sanitation» (DSNY),tätig und entwickelte öffentliche Performances, Ausstellungen und Kunstwerke im Stil der Land Art. Zu den bekanntesten Manifestationen zählt ihre zweijährige, umfassend dokumentierte Performance, bei der sie allen 8500 Beschäftigten des DSNY per Handschlag dafür dankte, «dass Sie New York City am Leben erhalten».
Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote
bei der Müllverbrennung tausende Tonnen Kohlendioxid entstehen, erweiterten das Konzept mit dem Vorschlag, die Abgase so zu manipulieren, dass sie regelmässig in Form eines 30 Meter breiten Rauchrings in die Luft geblasen würde. Das heisst: Der ganze Spass ist nur möglich, weil so viel Müll produziert wird, der verbrannt werden muss. Schade, dass die Kopenhagener Behörden das Kunst-Stück, das auf faszinierende Weise eine Verbindung zwischen Schrecken und Schönheit herstellte, nicht realisieren wollten. In ähnlicher Weise bereicherte Otto Piene 1976 mit seiner Arbeit «Black Stacks Helium Sculpture» die Ausstellung «The River: Images of the Mississippi» und akzentuierte die vier Schlote 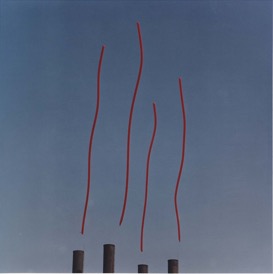 der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!
der Southeast Steam Plant in Minneapolis. Zu sehen waren rote mit Helium gefüllte Polyethylenschläuche, die 90 Meter hoch senkrecht über den Kaminen schwebten. Klar, dass die Installation subtil auf die Luftverschmutzung des Kraftwerks hinwies. Umso erstaunlicher aus heutiger Sicht, dass die Betreiber der Dampfzentrale, die sich dessen voll bewusst waren, die Installation tolerierten!
Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.
Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.
Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.

Einen ganz anderen Ansatz wählte, in der Ausstellung gleich daneben, Mierle Laderman Ukeles, als sie 1969 in einem Manifest Gedanken über Todestrieb und Lebensinstinkt nachdachte und dem Todestrieb den Willen zum eigenständigen, individuellen Lebensweg zuschrieb, der in der Kunst zur ständigen Erneuerung beiträgt. Im Gegensatz dazu sah sie als «Künstlerin, als Frau, als Ehefrau, als Mutter» den Lebensinstinkt als das ständige Bemühen, das Bestehende zu erhalten, indem das Neue bewahrt und der Fortschritt geschützt wird. Ihre, aus heutiger Sicht, etwas weit hergeholte Reflexion über ihr weibliches Künstlertum, führte sie dazu, den Fokus auf alle Formen der Pflege und der Reinigungsarbeiten zu richten, die gesellschaftlich zu wenig geachtet und geschätzt werden. So dokumentierte sie ihre häuslichen Routinen als Hausfrau und Mutter. Und 1973 fegte sie Eingangstreppe und Fussboden des schlossähnlichen «Wadsworth Atheneum»-Museums in Hartford (Connecticut). Seit 1977 war sie – unbezahlt – als Künstlerin bei

Botschaften gegen die Vermüllung der Umwelt und die Vergeudung von natürlichen Ressourcen – beide Begriffe schwingen im Titel «Territories of Waste» mit – bestimmen einen grossen Teil der ausgestellten Arbeiten. Aber es gibt auch Künstlerinnen und Künstler, die Hoffnung vermitteln, indem sie die desaströsen Gegebenheiten ironisch brechen. Da befasste sich zum Beispiel der Architekt Bjarke Ingels 2011 mit dem Entwurf einer Müllverbrennungsanlage in Kopenhagen. Der Plan sah eine begrünte hohe Aufschüttung vor, die auch als Skihügel genutzt werden kann, während im Innern Abfall verbrannt und mit der Abwärme 160’000 Haushalte versorgt werden konnten. Jan und Tim Elder und ihre Berliner Künstlergruppe «realities:united», im Wissen, dass

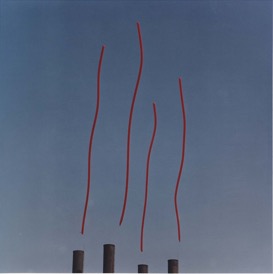
Es ist ein grosses Verdienst der Kuratorin, dass die deutsch/englische Begleitpublikation – 27 Franken in gedruckter Form, gratis als Download auf der Website des Museums – jedes einzelne der ausgestellten Kunstwerke ausführlich vorstellt. Sandra Beate Reimann verortet zudem in einem einleitenden, kenntnisreichen Essay die ausgestellten Werke in der Geschichte der zeitgenössischen Kunst. Gerade die Arbeiten Jean Tinguelys und mancher seiner Künstlerkolleginnen und -kollegen zeugen von einer scharfen Kritik am hemmungslosen Konsumismus der europäischen Wirtschaftswunderjahre und der amerikanischen Überflussgesellschaft. Tinguelys Rotozazas – Rotozaza II zertrümmerte 1967 im Loeb Student Center der New York University am laufenden Band (volle) Bierflaschen und Rotozaza III zertrümmerte 1969 12’000 Teller in einem Schaufenster des Kaufhauses Loeb in Bern – sind ein gutes Beispiel für die Art, wie Künstler am Ende der aufwühlenden 1960er-Jahre Gesellschaftskritik übten. Dass sie seit den 1950er-Jahren vielfach Schrott und Müll verarbeiteten, ist allerdings weniger als Statement für den Ressourcenkreislauf zu verstehen, vielmehr war die Zweitverwertung ihren prekären finanziellen Verhältnissen geschuldet: Sie hatten schlicht kein Geld, um ungebrauchtes Material zu kaufen.
Das Museum bietet während der Ausstellung ein umfangreiches Begleitprogramm, darunter die Neuerung des langen Donnerstag mit freiem Eintritt ab 18 Uhr. Details gibt es auf einem Flyer und auf der Website des Museums https://www.tinguely.ch/de/veranstaltungen.html.
Illustrationen: Oben: Anca Benera und Arnold Estefán: The Last Particles(Foto ©FRAC, courtesy Frac des Pays de la la Loire; Fanny Trichet. Mitte: Mierle Laderman Ukeles: Touch Sanitation Performance 1979-1980/2017. © Mierle Laderman Ukeles, Foto: Vincent Russo, courtesy the artist and Ronald Feldman Gallery, New York. Unten: Jan und Tim Elder,«realities:united», «BIG Vortex» 2011. Scan aus der Publikation zur Ausstellung. Ganz unten: Otto Piene: Black Stacks Helium Sculpture. 1978. ©2022 Pro Litteris, Zürich. Foto: courtesy Walker Art Center, Minneapolis.
Picasso und El Greco im Kunstmuseum Basel
09.06.22 08:02

Beim Rundgang durch die neun Räume der Ausstellung, möchten wir wissen, ob die These stimmt, dass Picasso sich praktisch während seiner ganzen Schaffenszeit immer wieder von Bildern El Grecos hat inspirieren lassen. Das Resultat ist wenig überraschend: Es gibt überzeugende Beispiele, wo die Wahlverwandtschaft frappant ins Auge sticht. Aber es gibt auch zahlreiche Momente, wo der Nachweis scheitert. Dies gilt insbesondere für viele der religiösen Motive El Grecos, die bei Picasso keine Resonanz erzeugen. So zum Beispiel, wenn Picassos Kreuzigungsbild («Die Kreuzigung Christi», 1930) El Grecos «Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel» (um 1610/14) zur Seite gestellt wird. Aber die kunsthistorischen Übertreibungen tun der hohen Qualität der Ausstellung keinen Abbruch. Es ist schön, die ausgeliehenen Bilder, sowohl die von Picasso als auch jene El Grecos, in Basel vor unserer Haustür sehen zu können. Und es ist wunderbar, Picassos Werke aus der Sammlung des Museums in diesem Kontext neu zu entdecken. Und besonders gelungen und hilfreich fanden wir die beiden wandfüllenden Zeittafeln, die das Wirken der beiden Künstler in den historischen Kontext stellen. Die ausführliche Chronologie ist auch im Katalog enthalten.
Nachtrag September 2022: Nach sorgfältiger Lektüre der kenntnisreichen Katalog-Aufsätze finden wir keine Anhaltspunkte, die uns unser skeptisches Urteil über die kuratorische These mit Überzeugung korrigieren liesse. Wir verzichten deshalb auf eine ausführliche Besprechung.
Den Katalog zur Ausstellung gibt es in einer deutschen und einer englischen Version. Er enthält Beiträge von Gabriel Dette, Carmen Giménez, Josef Helfenstein, Javier Portús und Richard Shiff: Giménez, C., Helfenstein, J. (Hrsg.): Picasso – El Greco. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 192 Seiten, € 44.00/CHF 50.50
Illustrationen: «Bildnis eines älteren Edelmannes» (El Greco, um 1587/1600), «Jaume Sabartés mit Halskrause und Haube» (Pablo Picasso, 1939)
Piet Mondrian in der Fondation Beyeler
03.06.22 17:14


Nach der Fondation Beyeler in Riehen zeigt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen die gemeinsam und in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Den Haag entstandene Mondrian-Schau vom 29. Oktober 2022 bis 10. Februar 2023 in Düsseldorf
Zur Ausstellung erschien (in einer deutschen und einer englischen Ausgabe) ein sehr schön von der holländischen Grafikerin Irma Boom gestalteter Katalog mit kenntnisreichen Essays und einem ausführlichen illustrierten biografischen Kapitel. Ulf Küster (Hrsg): Mondrian Evolution. Berlin 2022 (Hatje Cantz Verlag), 264 Seiten, CHF 58.00/€ 54.00.
Illustrationen: Porträt (Ausschnitt) von Arnold Newman: Piet Mondrian, 1942 in seinem Atelier in New York (Scan aus dem Katalog). Avond (Abend), Der rote Baum, 1908-1910 Kunstmuseum Den Haag, NL; Baum (1912?) Munson Williams Proctor Arts Institute, Museum of Art, Utica, NY; Bloeiende appelboom (Blühender Apfelbaum) 1912), Kunstmuseum Den Haag, NL.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung der Katalogbeiträge ist hier zu finden.
Jean-Jacques Lebel im Museum Tinguely
15.04.22 15:22
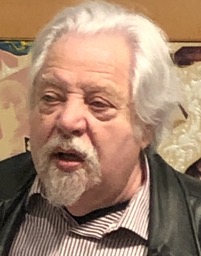
Die aufwändig zelebrierte Aktion war Teil der von Lebel, Jouffroy und Sergio Rusconi in der Galleria d’Arte Il Canale organisierten Ausstellung «L’anti-procès II», die als Gegenstück zur gleichzeitig stattfindenden Biennale verstanden werden wollte. Die Ausstellungsreihe hatte im Jahr zuvor mit «L’anti-procès I» in Paris als Protest gegen den mit grösster Grausamkeit geführten Algerienkrieg und den französischen Kolonialismus begonnen. In Venedig weitete sich der Blick: Nicht die Leistung nationaler Kunstszenen sollte gefeiert werden, wie sie die Biennale zelebrierte, sondern die Kunst als kulturelle Leistung der ganzen Menschheit. Jean-Jacques Lebel, 1936 im Pariser Vorort Neuilly geboren und in New York aufgewachsen, verstand sich

Den Porträts von Lebels Lieblingsdenkern stellte Kurator Andres Pardey logischerweise Jean Tinguelys Maschinen-Porträts von Henri Bergson und Pjotr Kropotkin aus dem Philosophen-Zyklus von 1988 gegenüber.
Mit dem Happening in Venedig – angeblich die erste derartige Intervention in Europa (wenn man Tinguelys spektakulären Umzug seiner fahrbar gemachten Skulpturen vom Pariser Atelier in der Impasse Ronsin in die Galerie des Quatre Saisons nicht mitzählt) – legte Lebel den Grundstein für seine Karriere als Künstler und als Kunsttheoretiker. Jean Tinguely, der in Venedig nicht dabei war, aber Lebel telefonisch sein Plazet zur Versenkung seiner Arbeit gab, hatte im März desselben Jahres bei der Selbstzerstörung seiner Plastik «Homage à New York» zusammen mit amerikanischen Künstlerfreunden den Weg gewiesen. Weder in New York noch in Venedig stiessen die Veranstaltungen auf Begeisterung. Nach den bis dahin geltenden Massstäben des bürgerlichen Kunstverständnisses konnte von Kunst nicht die Rede sein, wenn sich Künstler mit Kunstwerken Allotria trieben oder sie gar mutwillig zerstörten. «Wir waren damals alle Aussenseiter», sagte Jean-Jacques Lebel bei der Präsentation seiner Ausstellung. «Deshalb gab es einen grossen Zusammenhalt in der Kunstszene. Hierarchien und Eifersucht aufgrund des Erfolgs auf dem Kunstmarkt wie heute, existierten nicht», berichtete Lebel über den rebellischen Zeitgeist.
Um diesen Zeitgeist zu verstehen, ist es nützlich, sich nur schon die dichte Folge von erregenden Ereignissen zu vergegenwärtigen, die 1960 für Aufsehen sorgten: Am 13. Februar explodierte in der Sahara die erste französische Atombombe, zwei Wochen später, am 29. Februar, zerstörte ein Erdbeben in Marokko die Stadt Agadir; das Epizentrum lag direkt unter der Altstadt; 15’000 Menschen fanden den Tod. Am 1. Mai schoss die russische Luftwaffe ein amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug ab – eine gewaltige Blamage für die US-Regierung, zumal der Pilot gefangen genommen und später als Spion verurteilt wurde. Erwartungsgemäss scheiterte kurz darauf ein Gipfeltreffen der Supermächte in Paris. Am 23. Mai kidnappte ein Kommando des israelischen Geheimdienstes in Argentinien den Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann und brachte ihn nach Jerusalem. Und ähnlich rasant folgten auch in der zweiten Jahreshälfte, nach dem «Enterrement» von Tinguelys Skulptur, weitere spektakuläre Ereignisse.

Es wäre angesichts des Enthusiasmus, mit dem er die Erfindungen seines jugendlichen Furors auch als 86-Jähriger vorführt, ungerecht zu behaupten, Jean-Jacques Lebel habe in seinem Alterswerk den Glauben an die aufklärerische Kraft der Kunst aufgegeben. Sein zweites grosses Werk, das er in seiner Schau präsentiert, die Video-Installation «Les Avatars de Vénus» von 2007, ist mit Abbildungen von gemeisselten, gemalten, fotografierten und gefilmten nackten Frauenkörpern heutzutage zwar nicht mehr geeignet, brave Bürger zu schockieren, wie es seinerzeit die Happenings garantierten. Indem die 7000 Bilder aus der gesamten Kunstgeschichte, von der fast 30’000 Jahre alten«Venus von Willendorf» bis zur zeitgenössischen Stripperin, durch die Technik des Morphing ineinander übergehen, ergibt sich aber ein Panorama das durchaus der Intention von Lebels Revoluzzer-Generation entspricht, die Kunst als kollektive Leistung der ganzen Menschheit zu verstehen.
Die Ausstellung, wiewohl etwas abseits des grossen Rummels im zweiten Stock platziert, ist ein formidables Ergänzungsstück zur umfassenden Retrospektive «Party for Öyvind» im Erdgeschoss, die derselben Epoche gewidmet ist. Sie dauert allerdings nur noch bis zum 1. Mai.
Zitat aus: Jean-Jacques Lebel und weitere sieben weitere Mitunterzeichner: «Grundsätzliches zum Thema Happening» In: Jürgen Becker, Wolf Vostell (Hrsg.): Happenings. Fluxus, Pop Art, Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation. Reinbek b. Hamburg 1965 (Rowohlt Verlag), S. 357ff.
Zur Ausstellung erschien eine Begleitbroschüre, die über die ausgestellten Objekte hinaus einen Einblick in die Kunstbewegung des Anti-Procès und ihre künstlerischen Vorläufer im Surrealismus und im Dadaismus ermöglicht: Museum Tinguely Basel (Hrsg.), Andres Pardey (Texte): Jean-Jacques Lebel – L’enterrement de la Chose de Tinguely, Anti-Procès 1, 2, 3, Begegnung in NYC bei Teeny und Marcel. Basel, 2022. 44 Seiten, CHF 10.00.
Illustrationen: Oben: Porträt Jean-Jacques Lebel © 2022 Jürg Bürgi, Basel. Mitte: Besteigen der Gondeln zum «Enterrement» am 14.7.1960 am Canal Grande (Scan aus der Begleitbroschüre). Unten: Installationsansicht «Les avatars de Vénus» (© 2022,Museum Tinguely/Daniel Spehr)
«Party for Öyvind» im Museum Tinguely
21.02.22 11:03


Die ersten Ausstellungsobjekte zeigen Öyvind Fahlström als jungen Dichter, der seine Verse, die er 1954 mit dem ersten Manifest der konkreten Poesie fundierte, in den angesagten Magazinen. Übrigens: Der in Bolivien geborene Schweizer Dichter Eugen Gomringer (*1925), der bei uns als Begründer der konkreten Poesie gilt, publizierte sein eigenes Manifest «vom vers zur konstellation» erst einige Monate nach Oyvind Fahlström – und ganz unabhängig von ihm. Die beiden sind sich anscheinend nie begegnet.
Die zweite Etappe in seinem Künstler-Leben führte Fahlström nach Italien, zuerst, 1950, auf dem Trampelpfad der Archäologen in Rom, Neapel, Sizilien und Sardinien. Zwei Jahre später kehrte er zurück und schrieb von Rom aus als Journalist für Tageszeitungen und Kunstmagazine über alle möglichen Erscheinungen des Kulturbetriebs. Seine Tätigkeit machte Kontakte zu Künstlern und Kulturschaffenden aller Art möglich. Besonders beeindruckte ihn der Maler und Grafiker Giuseppe Capogrossi (1900-1972), von dem er sich zu eigenen Bildern inspirieren liess. Zu seinen Freunden zählte auch der chilenische Architekt, surrealistische Maler und Bildhauer Roberto Matta (1911-2002), dessen Werke 1959 in der ersten Ausstellung des neu gegründeten Moderna Museet in Stockholm gezeigt wurden. Im schwedischen Maler Olle Ängkvist (1922-2006) entdeckte Fahlström einen Gleichgesinnten: neugierig, furchtlos und offen für die weite Welt. Diese weite Welt verkörperten in den 1950er-Jahren in Rom die Amerikaner, vor allem Robert Rauschenberg (1925-2008), der sich im legendären Black Mountain College in den Bergen North Carolinas in seinen Mitstudenten Cy Twombly (1928-2011) verliebt hatte und ihn überredete, mit ihm nach Rom zu ziehen. Fahlström war 1954 von den Arbeiten seines Jahrgängers Twombly, die er in einer Tour durch die Galerien sah, zuerst wenig beeindruckt. Immerhin kehrte er zurück, traf den bisher erfolglosen Maler persönlich und schrieb im schwedischen Magazin «Konstrevy» die erste positive Besprechung.

Der grösste Raum der Ausstellung ist den rund 15 Jahren gewidmet, in denen die künstlerische Vorhut in New York den Ton angab – im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinn. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Elektroingenieur Billy Klüver (1927-2004), «der Edison-Tesla-Steinmetz-Marconi-Leonardo da Vinci der amerikanischen Avantgarde», wie ihn die Illustrierte LIFE einmal nannte. Klüver, in Monaco als Kind norwegisch-schwedischer Eltern geboren und in Schweden aufgewachsen, stellte seine technischen Kenntnisse in den Dienst vieler Künstler, unter anderem von Jean Tinguely, dem er 1960, zusammen mit Robert Rauschenberg half, im Garten des MoMA seine selbstzerstörerische Skulptur «Homage à New York» zu bauen. Unentbehrlich war Klüver auch 1966 bei der Organisation von «9 Evenings: Theatre and Engineering», einer Reihe von Performances, die Künstler und Ingenieure gemeinsam entwickelten. Beteiligt waren zehn Künstlerinnen und Künstler – John Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor und Robert Whitman - und etwa 30 Ingenieurinnen und Ingenieure. Die «9 Evenings» waren auch die Geburtsstunde der Organisation E.A.T. (Experiments in Art andTechnology), die Künstlerinnen und Künstler mit dem neusten technischen Knowhow unterstützte.
Barbro Schultz Lundestam besuchte Billy Klüver und seine Frau Julie Martin 1993 und erhielt Zugang zum Archiv des E.A.T.-Projekts, das mit seinen 16mm-Filmen, Fotos und Dokumenten eine unschätzbar wertvolle Quelle der Avantgarde darstellte. Auf Initiative von Robert Rauschenberg gestaltete Barbro Schultz aus dem Material zehn Dokumentarfilme und publizierte 2004 das Buch «Teknologi för livet. Om E.A.T.»

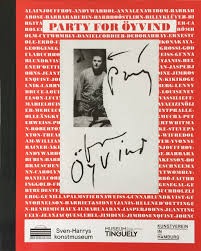
Barbro Schultz Lundestam: Party for Öyvind. Stockholm 2021 (Schultz Förlag AB), 438 Seiten, ca. 480SKr/CHF 50.00 (nur in englischer Sprache erhältlich).
Illustrationen von oben nach unten: Einladungskarte von Claes Oldenbourg zur Party für Öyvind Fahlström; Öyvind Fahlström, Section of World Map - A Puzzle, 1973, Private Collection; Öyvind Fahlström, The Cold War, 1963-1965, Centre Pompidou, Paris - Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle. © ProLitteris, Zürich; Joan Kron, Öyvind Fahlström und Jean Tinguely bei «Construction of Boston», 1962, Privatsammlung; Katalogbuch «Party for Öyvind» (Umschlag).
Meret Oppenheim im Kunstmuseum Bern
03.02.22 15:10

Meret Oppenheim wurde in Berlin-Charlottenburg als Tochter des deutschen Arztes Erich Oppenheim und seiner Schweizer Frau Eva Wenger geboren. Während des Ersten Weltkriegs lebte sie mit Ihrer Mutter, der Tochter der Malerin und Kinderbuchautorin («Joggeli söll ga Birli schüttle») Lisa Wenger (1858-1941), in Delémont. Nach dem Krieg zog die Familie nach Steinen bei Lörrach, wo Meret die Primarschule besuchte. Die Oberrealschule in Schopfheim, eine Privatschule in Zell im Wiesental, die Rudolf-Steiner-Schule in Basel, ein Mädcheninternat im Schwarzwald und die Oberschule in Lörrach waren weitere Stationen einer bewegten Schulkarriere. 1931 machte sie Schluss damit. Sie wusste, dass sie Malerin werden wollte und wandte sich in Basel dem Kreis junger Künstler um Walter Kurt Wiemken (1907-1940), Walter Bodmer (1903-1973) und Otto Abt (1903-1982) zu, die sich später zur antifaschistischen «Gruppe 33» zusammentaten. Dort befreundete sie sich mit der vier Jahre älteren, bereits Paris-erfahrenen


Zurück zur Berner Ausstellung: Ihr Titel erinnert an eines der letzten Projekte von Meret Oppenheim, die das Konzept einer ihr gewidmeten Retrospektive selbst entwickelte und 1984 in der Berner Kunsthalle auch ausführte. Beginnend 1929 und endend 1985 folgt die aktuelle Rückschau der vorgegebenen chronologischen Ordnung auf zwei Stockwerken des Museums. In ihren Werken begegnen wir einer selbstbewussten, unabhängigen Künstlerin, die sich mehr von ihren Träumen und ihrer kreativen Intuition inspirieren liess als von einem künstlerischen Programm. Die frühe Prägung durch den Surrealismus ist der rote Faden in diesem Werk, auch wenn die Künstlerin das als oberflächliche Zuschreibung empfand. So sprunghaft sie scheinbar ihren Einfällen folgte, so beständig setzte sie sich mit einigen Konstanten auseinander. Da die Schau keine Schwerpunkte setzt, müssen sie Besucherinnen und Besucher selbst entdecken. Immer wieder setzte sich Meret Oppenheim zum Beispiel mit der Sage von Genoveva auseinander. In der Ausstellung haben wir das Sujet in vier Variationen gezählt: 1939, 1942, 1956 und 1971. Die historisch nicht belegte Geschichte (nicht zu verwechseln mit der Legende von der Heiligen Genoveva von Paris) kreist um die Leiden einer Tochter eines Herzogs von Brabant und Gemahlin eines Pfalzgrafen Siegfried und spielt der Überlieferung nach um 720. Im Zentrum steht die Treue der Genoveva zu ihrem im Kriegsdienst für seinen König abwesenden Ehemann. Aus Frust über ihre Zurückweisung bezichtigte sie der Statthalter Siegfrieds des Ehebruchs mit einem Koch. Der Todesstrafe entging sie nur dank der Barmherzigkeit des Henkers. Sie musste sich in der Folge im Wald verstecken, wo sie mit ihrem kleinen Kind sechs Jahre lang in einer Höhle lebte, versorgt durch eine von der Gottesmutter gesandte Hirschkuh. Die Geschichte, mutmasslich im 14. Jahrhundert zum ersten Mal niedergeschrieben und später in mehreren Versionen erweitert und ausgeschmückt, endet mit Genovevas Befreiung durch Siegfried und die Hinrichtung des intriganten Statthalters.


1984, 14 Monate bevor sie im Basler Kantonsspital an einem Herzinfarkt starb, eröffnete sie in der Berner Kunsthalle unter dem Titel «Mon exposition» ihre selbst konzipierte Retrospektive, der, wie oben erwähnt, die aktuelle Berner Ausstellung nachgebaut ist. Um sich in der Überfülle der Werke zu orientieren, sind die Erläuterungen in der Broschüre mit den Saaltexten zu den einzelnen Räumen eine sehr gute Hilfe.
Verwendete Zitatquellen: Wenger, L. und Corgnati, M. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Worte nicht in giftigen Buchstaben einwickeln. Das autobiografische Album «Von der Kindheit bis 1943» und unveröffentlichte Briefwechsel. Zürich 2013 (Verlag Scheidegger & Spiess).
Meyer-Toss, Christiane. (Hrsg.): Meret Oppenheim – Träume und Aufzeichnungen. Berlin 2010 (Suhrkamp Verlag).
Illustrationen: Plakat «Mon Exposition» im Kunstmuseum Bern 2021/22; Meret Oppenheim und Irène Zurkinden; Meret Oppenheim an der Vernissage ihrer Ausstellung in Duisburg 1972 (akg-images / Brigitte Hellgoth / © 2021, ProLitteris, Zürich); «Genoveva» (1971 nach einem Entwurf von 1942); Brunnen auf dem Waisenhausplatz in Bern (1983).
Merci Seppi: Die grosse Schenkung im Museum Tinguely
16.11.21 15:15

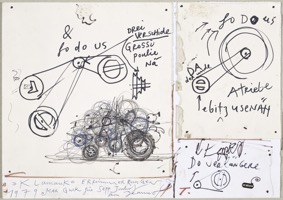

Illustrationen: Donator Seppi Imhof präsentiert seine Ausstellung (© Jürg Bürgi, Basel, 2021); Jean Tinguely. Klamauk – Erinnerungen 1979 (Museum Tinguely, Basel. Schenkung Josef Imhof; ©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel. Jean Tinguely: Charlotte OK, 1990. (museum Tinguely, Basel, Schenkung Josef Imhof.©2021 Pro Litteris, Zürich; Museum Tinguely Basel.
Zum 100. Geburstag von Celestino Piatti
04.11.21 16:09



Der zweite Teil des Buches ist ganz der dreissigjährigen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Taschenbuchverlag gewidmet, für den Piatti im Laufe der Zeit nicht nur rund 6300 Buchumschläge entwarf, sondern für das von elf renommierten Buchverlagen zur Zweitverwertung ihrer Produktion gegründete Gemeinschaftsunternehmen die Corporate Identity entwickelte – Briefpapier, Prospekte, Plakate. Mit dem Verleger Heinz Friedrich verband ihn nicht nur eine solide, professionelle Geschäftsbeziehung, sondern auch eine herzliche Freundschaft. Piatti, erinnerte sich Heinz Friedrich, «verfügte über eine schier unbegrenzte Bildfantasie» und «über einen Sinn für das praktisch Machbare … wie ich das bisher in solcher Übereinstimmung bei einem Grafiker noch nie erlebt hatte: der Künstler als Handwerker, und der Handwerker als Künstler». Auf das Handwerk des Grafikers legen die Herausgeberin und der Herausgeber des Buches besonderes Gewicht. An zahlreichen Beispielen zeigen sie, wie sich Celestino Piatti zeitlebens in der analogen Welt einrichtete. Seine Werkzeuge waren Pinsel, Federn und Farbstifte, Wasserfarben und Tusche, Schere und Federmesser, Transparentpapier und Leim. Texte musste er setzen und drucken lassen, um sie anschliessend mit seinem Bildentwurf zu verbinden. Das war jeweils – gerade bei den Buchumschlägen – ein aufwändiges Hin und Her zwischen Basel und München.


Zum reichhaltigen, hoch professionell inszenierten Material im wunderbaren Jubiläumsbuch gehören auch persönliche, mit Bildern aus dem privaten Fotoalbum illustrierte Erinnerungen der Familie Piatti. Aufschlussreich sind auch die Auszüge aus dem intensiven Briefverkehr zwischen dem dtv-Verleger Heinz Friedrich und seinem Art Director Piatti sowie Äusserungen von rund 40 Freunden, Bekannten und anderen Zeitzeugen.
Wir werden auf das Buch, gelegentlich in einem ausführlichen Bericht zurückkommen und dabei besonders auf die Arbeit Piattis für den Deutschen Taschenbuchverlag eingehen, welche die Buchgestaltung und -Präsentation in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat.
Miozzari, C. und Piatti, U. (Hrsg.): Celestino Piatti. Alles, was ich male, hat Augen/Everything I Paint Has Eyes, Basel und München 2021 (Christoph Merian Verlag/dtv) 410 Seiten, CHF 59.00/€ 59.00
Autorinnen und Autoren: Claudio Miozzari, Barbara Piatti, Sven Behrisch, Herwig Bitsche, Thomas Broch, Raffael Dörig, Gabriele Ewenz, Fabian Harb, Barbara Junod, Christine Lötscher, Lucas Manser, Philipp Messner, Jens Müller, Jochen Overbeck, Andreas Platthaus, Bettina Richter, Heinz Stahlhut, Maren Stotz, Thomas Streifeneder, Bruno Weber, isabel Zürcher.
Zeitgleich mit dem Erinnerungsbuch publiziert der NordSüd Verlag, Zürich, Piattis sieben Kinderbücher in einem Sammelband unter dem Titel
«Piatti für Kinder» Zürich 2021 (NordSüd Verlag), 220 Seiten, CHF 37.90/€ 30.00
Die Sonderausgabe mit einem Kunstdruck von einer Linolplatte aus dem Nachlass in einer Auflage von 200 Exemplaren kostet CHF 120.00/€100.00.

In Grellingen BL ist vom 26. bis 28. November, jeweils von 10 bis 20 Uhr das Piatti-Archiv öffentlich zugänglich. Auch am 5. Januar 2022, dem 100. Geburtstag Celestino Piattis, von 16-22 Uhr und am 8. und 9. Januar 2022 von 10 bis 20 Uhr ist das Archiv offen. Eine Anmeldung auf der Website www.celestino-piatti.ch/archiv-tage ist erforderlich. Ein Covid-19- Zertifikat ist Pflicht.
In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus feiert München vom 13.-16. Januar 2022 Piatti-Tage. Und in Zürich plant der NordSüd Verlag vom 4. bis 6. März 2022 einen Jubiläums-Anlass.
Weitere Informationen www.celestino-piatti.ch/piatti-tage
Illustrationen: Celestino Piatti mit Taschenbuch-Drehständer in seinem Basler Atelier (Scan aus dem besprochenen Buch, S. 219); Piattis Vorlage für das Cover der Zeitschrift «Graphis» 115, 1964. Archiv Piatti; Druckvorlage des Hamster-Plakats für die BKG/Liga ca. 1973 (Scan aus dem bespr. Buch, S. 79); Piattis Eulenglück, niederländische Ausgabe; «Südliche Fischerboote», Lithografie, 73x55cm; Blick ins Piatti-Archiv in Grellingen (Foto © Basil Huwyler, 2021).
«Écrits d’Art Brut – Wilde Worte und Denkweisen» im Museum Tinguely
20.10.21 16:25





Zur Ausstellung erscheint eine Publikation in französischer Sprache.
Peiry, Lucienne: Écrits d’art brut. Graphomanes extravagants. Paris 2020 (Le Seuil), 288 Seiten, € 31.00.
Illustrationen von oben: Giovanni Bosco (Wandmalerei in Casellamare del Golfo (Sizilien), 2008., Arthur Bispo Rosário (Manto de apresentação, Ausschnitt, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Pascal Vonlanthen (SWISSClou, 2019); Giovanni Battista Podestà (Der Künstler im Kostüm, Bild aus der Ausstellung © Jürg Bürgi 2021); Adolf Wölfli (Santta-Maria-Burg= Riesen-Traube: 100 Unitif Zohrn Tonnen schwer,1916).
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung unter Berücksichtigung des Katalogs ist geplant.
«Here We Are!»: Design von Frauen im Vitra Design Museum
24.09.21 12:46



Der dritte Raum widerspiegelt unter dem Titel «In Bewegung 1950-1990» die Dynamik der Nachkriegsjahre, die auch der Kreativität von Gestalterinnen neue Möglichkeiten eröffnete. Die zentrale Botschaft dieses dritten Ausstellungsteils ist die Überwindung des traditionellen Frauenbilds. Wie langsam dies geschah, wird am Beispiel der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit SAFFA 1958 in Zürich vorgeführt. Ihre Vorgängerin, 1928 in Bern, sollte die politische Emanzipation der Schweizer Frauen voranbringen. Dreissig Jahre später ging es um die Würdigung und Förderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leistung der Frauen. Dass dies in einer irgendwie verklemmten Form geschah, indem ein überaus konservatives Frauenbild präsentiert wurde, das alle Klischees einer bürgerlichen Frauenexistenz bediente.

Gleichzeitig, auf der andern Seite des Eisernen Vorhangs, gestaltete die russische Architektin Galina Balaschowa (geb. 1931) ab 1963 die Innenräume der sowjetischen Orbitmodule von vier verschiedenen Sojus-Modellen, später von mehreren Raumstationen und der Raumfähre Buran. Sie übernahm auch das Design von Medaillen und Emblemen. In einem Interview mit der beratenden Kuratorin Aljona Sokolnikowa, das im Programm zur Ausstellung abgedruckt ist, betont die Gestalterin, dass sie bei ihrer Arbeit künstlerisch immer frei arbeiten konnte, wohl auch, weil ihrer Ansicht nach «in all den Jahren nie jemand wirklich begriff, was ich da eigentlich

Im vierten Kapitel entfaltet sich ein Panorama der gegenwärtigen Designerinnen-Szene. Die Gestalterinnen führen ihre eigenen Studios und arbeiten als Entwerferinnen unter ihrem eigenen Namen. Die Vorstellung, dass gestalterische Begabung oder Kreativität etwas mit dem Geschlecht zu tun haben, sei zwar längst überwunden, heisst es im Saaltext, aber Ungleichheiten seien weiterhin vorhanden, wie der zeitgenössische feministische Diskurs belege. Das ist allerdings ein weites Feld, und es scheint, dass sich die Ausstellungsmacherinnen versuchten, einer eindeutigen Stellungnahme zu entziehen, indem sie einzelne Standpunkte nebeneinander stellten. Interessanter ist die Weitung des Blicks weg von der eurozentrischen Sichtweise, hin auf die Design-Traditionen und neue Entwicklungen in Afrika und anderswo.
Insgesamt bietet die Ausstellung «Here We Are! – Frauen im Design 1900 - heute» eine überaus facettenreiche Fülle von Anschauungsmaterial von rund 80 Gestalterinnen. Es ist sehr zu bedauern, dass es keine Publikation gibt, die diese Fülle festhalten, begründen und einordnen könnte.
Illustrationen: Key Visual der Ausstellung »Here We Are!« © Vitra Design Museum, Illustration: Judith Brugger, Objekt: Faye Toogood, Roly Poly, 2018, Foto: Andreas Sütterlin; Charlotte Perriand auf der Chaise longue basculante, 1929, Perriand und Jeanneret © VG Bild-Kunst. Bonn 2021, Le Corbusier: F.L.C./ VG Bild-Kunst, Bonn 2021; Ray Eames bei der Arbeit an einem Modell, 1950, © Eames Office LLC; Plakat für die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, SAFFA, Zürich, 1958, Gestaltung: Nelly Rudin Plakatsammlung Schule für Gestaltung Basel, Copyright für Nelly Rudin: © VG Bild-Kunst, Bonn 2021; Galina Balaschowa, Skizze des Innenraums des orbitalen (Wohn-)Abteils des Sojus-Raumschiffs. Variante 1, 1963, © Kosmonautenmuseum, Moskau
«Close-Up»: Neun Porträtistinnen in der Fondation Beyeler
18.09.21 15:42

Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein schön gestalteter, reich illustrierter Katalog mit kenntnisreichen Künstlerinnen-Porträts und sorgfältig kommentierten Chronologien.
Vischer, Theodora (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Close-Up. Berthe Morisot, Mary Cassatt, Paula Modersohn-Becker, Lotte Laserstein, Frida Kahlo, Alice Neel, Marlene Dumas, Cindy Sherman, Elisabeth Peyton. Riehen/Berlin 2021 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 342 Seiten, CHF 58.00/€ 58.00.
Illustration: Frida Kahlo, Selbstporträt (1926)
Pissarro: Das Atelier der Moderne im Kunstmuseum Basel
03.09.21 17:36

Pissarro, 1830 als Sohn einer ursprünglich aus Portugal stammenden jüdischen Familie auf der damals dänischen Karibik-Insel St. Thomas geboren, begann seine Malerkarriere gegen den Widerstand seines Vaters als 22-jähriger im Schlepptau des dänischen Malers Fritz Melbye in Venezuela. Nach einem kurzen Zwischenhalt bei der Familie, wo er seinen Vater überzeugte, seine Malerkarriere zu akzeptieren, reiste Pissarro 1855 nach Paris. Zunächst als Schüler des führenden Landschaftsmalers Camille Corot (1796-1875), später – auf Drängen des Vaters – auch kurz in der Ecole des Beaux-Arts, suchte der junge Künstler nach seinem eigenen künstlerischen Weg. Unter seinen Zeitgenossen war die Überwindung der sterilen realistischen Ateliermalerei ein ständiges Debattenthema. Die «Schule von Barbizon», um 1830 von Théodore Rousseau (1812-1867) im Wald von Fontainebleau gegründet, galt vielen als Vorbild für die moderne, naturverbundene Landschaftsmalerei. Die Mitglieder der Gruppe skizzierten im Freien und gingen nur zur Fertigstellung ihrer Bilder ins Atelier. Camille Pissarro und einige seiner

So einflussreich Camille Pissarro in seinem Kreis war, so wenig erfolgreich war er als Verkäufer seiner Werke. Anders als einige seiner Freunde, darunter Jean Renoir oder Claude Monet, weigerte er sich, seine Malweise dem Publikumsgeschmack anzupassen. Es widerstrebte ihm, zugunsten des kommerziellen Erfolgs künstlerische Kompromisse einzugehen. In der Ausstellung ist an zahlreichen Beispielen zu sehen, wie revolutionär die Impressionisten den zeitgenössischen Geschmack mit ihrer Malerei herausforderten. Da sie ihre Werke in den offiziellen Verkaufsausstellungen, den «Salons», nicht präsentieren konnten, veranstaltete die Gruppe unter Pissarros Führung als «Société anonyme cooperative des artistes, peintres, sculpteurs, et graveurs» 1874 eine erste Ausstellung. Sie war gewusst als Provokation gemeint und folgerichtig von der Kritik als Schau der «Impressionisten» verunglimpft. Bis 1886 veranstaltete die Gruppe acht Ausstellungen. Camille Pissarro war der einzige Maler, der immer dabei war. Die Beharrlichkeit zahlte sich nicht aus. Er war mit seiner grossen Familie – seine Frau Julie gebar fünf Söhne und drei Töchter, von denen nur eine das Kindesalter überlebte – immer wieder auf Unterstützung angewiesen.
Der Kreativität und der Offenheit für Neues tat das keinen Abbruch. Mit der aus Amerika stammenden Künstlerin Mary Cassatt (1844-1926) und Edgar Degas (1834-1917) erprobt er in den späten 1870er Jahren die Möglichkeiten, die impressionistische Wiedergabe von Lichtreflexen in Radierungen anderen Druck-Techniken einzusetzen. Die lange in Vergessenheit geratene Mary Cassatt ist in der Ausstellung mit fünf Kaltnadelradierungen aus einer späteren Schaffensperiode präsent. Zwei der Arbeiten aus dem Jahr 1891 könnte man schon fast dem Jugendstil zuordnen.
Pissarro hatte die Selbstverwaltung seiner Impressionisten-Freunde auch aus politischen Gründen gewählt. Als überzeugter Anarchist und Bewunderer des Vordenkers Pjotr Kropotkin unterstützte er die Bewegung und agitierte gegen die prekären Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse. Seine Überlegungen formulierte er in einer Broschüre mit dem Titel «Turpitudes sociales», die er mit satirischen Zeichnungen illustrierte und seinen Nichten schenkte.

Auf seiner letzten künstlerischen Etappe, ab 1893, malte Camille Pissarro mit Vorliebe Stadtlandschaften. Erstmals kann er es sich leisten zu reisen. Er mietet Wohnungen in verschiedenen Städten, von deren Fenster aus er das Leben auf den Strassen beobachtet und malt, zum Teil dasselbe Motiv zu verschiedenen Tageszeiten. Besonders faszinieren ihn Häfen, die er in Dieppe, Rouen und Le Havre abbildet.
Auch wer sich weniger für die Details der impressionistischen und neoimpressionistischen Malweise interessiert, wird das grossartig präsentierte Panorama von Camille Pissarros Werk und seines «Atelier der Moderne» als grossen Kunstgenuss erleben.
Zur Ausstellung erschien ein sowohl mit aufschlussreichen Texten als auch mit üppiger Illustration auftrumpfender Katalog in je einer deutschen und einer englischen Version.
Helfenstein, J. und Duvivier, Chr.: Camille Pissarro: Das Atelier der Moderne. München 2021 (Prestel Verlag). 336 Seiten, CHF 59.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
Illustrationen: Camille Pissarro um 1900 (Fotograf unbekannt), Camille Pissarro; Côte des Boeufs, Pontoise (1877), Camille Pissarro: Les Glaneuses (1889). Dieses Bild, das bisher als Leihgabe zur Sammlung gehörte, wurde dem Museum kurz vor Ausstellungseröffnung geschenkt.
Neun Filme von Bruce Conner im Museum Tinguely
04.05.21 14:08


Ausser den ausrangierten Kähnen ist von all dem auf den von unzähligen an Land, auf See und in der Luft positionierten Kameras aufgenommenen Bildern nichts zu sehen. Sie zeigen die unvorstellbare Wucht der Atombomben-Explosion, welche die ganze Umgebung mit radioaktivem Sprühregen verseuchte, aber auch die makaber-faszinierende Schönheit des Gewaltaktes. Musikalisch begleitet wird der 35mm-Tonfilm im ersten Teil von atmosphärisch auf das Gezeigte abgestimmten Synthesizer-Klängen von Patrick Gleeson; der zweite Teil, der die irritierende Ästhetik des zerstörerischen Menschenwerks zelebriert, wird von hypnotischen elektronischen Tonfolgen untermalt, die Terry Ripley komponierte. Der eindrückliche 37 Minuten lange Zusammenschnitt der Archivaufnahmen läuft im Museum gleich neben dem offen zugänglichen Raum mit Jean Tinguelys Mengele-Totentanz. «Die Nachbarschaft …», heisst es im Begleittext, «will einen Dialog eröffnen über die politischen Gefahren von Militarismus und Totalitarismus».


In einem Interview gefragt, wie er eigentlich dazu kam, Filme zu machen, antwortete Conner, das sei ihm auch nicht ganz klar. Er sei häufig ins Kino gegangen und habe Ideen zu einem eigenen Film entwickelt. Und weil niemand ihn habe machen wollen, sei er gezwungen gewesen, es selbst zu versuchen. Die Äusserung ist typisch für Conners öffentliche Auftritte. Man weiss nie, ob er sich über die Fragerei lustig macht, oder ob er es ernst meint. Den ganzen Kunstbetrieb betrachtete er mit ironischer Distanz, manchmal auch mit Verachtung. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass er auf den Rummel und seine Zumutungen angewiesen war, wenn er sein fast schrankenloses kreatives Potenzial ausschöpfen wollte. Denn auf die Filmmontage und die Erfindung von zum Teil surrealistischen Bildsequenzen (wie zum Beispiel in dem psychedelisch-experimentellen Farbfilm «Looking for Mushrooms») war Conners Begabung bei weitem nicht beschränkt: Er erregte mit erotischen Gemälden Aufsehen, er zeichnete, fotografierte, schuf Tapisserien, Collagen und Assemblagen, die an Arbeiten von Dieter Roth oder Daniel Spoerri erinnern. Und in vielen Fällen wollte Conner seine Werke als Kommentar zu aktuellen Ereignissen verstanden wissen. (Zum Beispiel die hier abgebildete Skulptur CHILD von 1959/60, die als Beitrag zur damals heftigen Auseinandersetzung um die Hinrichtung von Caryl Chessman, der in der Haft mehrere Bücher schrieb und bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, verstanden wurde. Dass sich die aktuelle Ausstellung im Museum Tinguely ganz auf den Filmemacher Conner

Die letzte Retrospektive auf Conners Schaffen fand im Juli 2016 unter dem Titel «It’s All True» als Kooperation des San Francisco Museum of Modern Art und des New Yorker Museum of Modern Art statt. Die New York Times nannte die Schau, auf der nicht weniger als 250 Werke in rund zehn verschiedenen Kunst-Techniken zu sehen waren, eine «Extravaganz» und einen Beweis «grösster Wertschätzung». Auch andere Kritiken enthielten nur höchstes Lob. Es wäre dringend zu wünschen, dass sich auch in Europa einmal Museen zusammenfänden, um dem grossen Anreger Bruce Conner, allen Schwierigkeiten zum Trotz, mit einer umfassenden Schau den verdienten Tribut zu zollen. Bis dann begnügen wir uns, nolens volens, mit den neun Filmen im Museum Tinguely. Und das ist immerhin schon sehr viel.
Illustrationen von oben nach unten: Porträt © NYT Bruce Conner in 2000. Peter DaSilva (Ausschnitt); Filmstills aus «Crossroads», «A Movie» und «Report» Courtesy Kahn Gallery und Conner Family Trust (© Conner Family Trust); CHILD (959/60). © Museum of Modern Art, New York.
Ólafur Elíasson in der Fondation Beyeler
27.04.21 12:57


Das ist ganz im Sinne des Künstlers. «Das Leben auf der Erde», gibt er in einem Statement zu Bedenken, «hatte schon mindestens drei Milliarden Jahre überstanden, bevor [es Menschen gab] ... Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir ‹auserwählte› Spezies sind, für die alle anderen gemacht wurden. Und wir sind auch nicht die wichtigste Spezies, nur weil wir so zahlreich, mächtig und gefährlich sind.» Und Sam Keller, Direktor des Museums, bezieht das Publikum mit ein, wenn er von einem «kollektiven Experiment» spricht, das Elíassons Installation darstellt. «Es stellt Konventionen von Kunst, Natur, Institution und Leben in Frage und versucht ihre Grenzen zerfliessen zu lassen.» Sein Werk, erklärt Elíasson, sei nicht nur für menschliche, sondern ebenso für nichtmenschliche Besuchende gemacht, für Pflanzen und Mikroorganismen.

In der Tat wirkt wohl Elíassons Werk am nachhaltigsten durch seine dystopische Perspektive nach: Da ist nicht nur ein Kunstmuseum ohne Kunst zu besichtigen, sondern auch die Aussicht darauf, dass menschliche Kreativität, ja die ganze Spezies, eines Tages ohne weiteres verschwinden und ihre Kultstätten von der Natur zurückgeholt werden. Das Memento Mori, hatte als Grundthema der bildenden Kunst während Jahrhunderten das Individuum im Fokus. Elíassons eindrückliche Installation weitet die Mahnung nun auf die ganze Menschheit aus.
Illustrationen © Jürg Bürgi 2021
Jonas Fränkels Nachlass im Schweizerischen Literatur-Archiv
25.04.21 12:06

Julian Schütt: Germanistik und Politik. Schweizer Literaturwissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus. Zürich 1996 (Chronos-Verlag).
Hier geht es zum vollständigen, als PDF neu formatierten und illustrierten Text der Story im Archiv unserer Website.
Illustration: Jonas Fränkel (Schweiz. Literaturarchiv)
Sophie Taeuber-Arp im Kunstmuseum Basel
20.03.21 10:52

In neun Räumen begegnen wir hier, meist in chronologischer Ordnung arrangiert, dem Oeuvre einer Frau, die wohl allzu lange als tüchtige und einfallsreiche Kunstgewerblerin missverstanden wurde. Dabei wird schon in den frühen Arbeiten deutlich, dass Sophie Taeuber, die von ihrer Mutter nach Kräften gefördert, an der Gewerbeschule in St. Gallen und später in München und Hamburg eine solide künstlerische Ausbildung genoss, zwischen angewandter und «freier» Kunst keinen Unterschied machte. (Es scheint, dass die Unterscheidung weniger von Künstlerinnen und Künstlern gemacht wurde und wird – man denke an Sonja Delaunay, Hannah Höch oder an Anni Albers, aber auch an Le Corbusier, an Pablo Picasso, Max Bill, Theo van Doesburg und viele andere – als vielmehr von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern und ihrem praxisfernen Schubladendenken.) Bei Sophie Taeuber-Arp trat zur ungewöhnlichen Breite von Begabungen ein starker Entdecker-Drang hinzu, der sie fortwährend Neues ausprobieren liess.

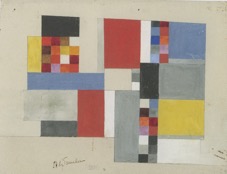

Im Sommer 1940 flohen die Arps vor den Nazi-Truppen aus Clamart. Peggy Guggenheim lud sie nach Veyrier-sur-Lac in Savoyen ein, um dort auf das Visum für die Schweiz zu warten. Nach der Ablehnung des Antrags zogen sie nach Grasse weiter. Die künstlerischen Arbeiten, die Sophie Taeuber in diesen Jahren vollendete, sind geprägt vom Material-Mangel und der Ruhelosigkeit der Emigration. Kurz vor der Besetzung Südfrankreichs durch deutsche und italienische Truppen konnten sich die Arps mit einem befristeten Visum nach Zürich absetzen. Wenige Wochen später, in der Nacht auf den 14. Januar 1943, starb Sophie Taeuber-Arp im Schlaf an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, weil im Gästezimmer in Max Bills Haus der Abzug am Holzofen geschlossen war.
Illustrationen: Sophie Taeuber-Arp mit Dada-Kopf (Scan aus dem Katalog, S. 116; Foto: Nic. Aluf (1885-1959), Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris; «Hirsch» (Marionette für König Hirsch) 1918, Museum für Gestaltung, Zürcher Hochschule der Künste, Kunstgewerbesammlung. Courtesy Umberto Romito, Ivan Suta; Aubette 200 (Entwurf für die Decke der Aubette-Bar in der Aubette, Strassburg)

Die umfangreiche und sehr schön gestaltete Publikation zur Ausstellung gibt es in einer englischen und einer deutschen Ausgabe: Umland, A., Krupp, W., Healy, Ch. und (für die deutsche Ausgabe) Reifert, E., Beck, C. (Hrsg. für das Museum of Modern Art, New York und das Kunstmuseum Basel): Sophie Taeuber-Arp – Gelebte Abstraktion. München 2021 (Hirmer Verlag), 352 Seiten, € 58.00/CHF 59.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
«Impasse Ronsin» im Museum Tinguely
16.12.20 10:52



Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog, der das Leben in der Sackgasse in seiner ganzen Fülle mit Bildern, Erinnerungen und Anekdoten abbildet. Er ist in einer deutschen und englischen Version erhältlich.
Museum Tinguely (Hrsg.): Impasse Ronsin. Mord Liebe und Kunst im Herzen von Paris. Basel/Heidelberg 2020 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 252 Seiten. CHF 42.00/€ 38.00
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
Illustrationen von oben nach unten: Die Impasse Ronsin am Ende des 19. Jahrhunderts und heue (Postkarte/Google Streetview), Titelseite des Petit Parisien zum Mordfall Steinheil, 14. Juni 1908, Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely 11.4.1961 (Foto Shunk-Kender).
Auguste Rodin und Hans Arp in der Fondation Beyeler
13.12.20 11:12

Zur Ausstellung erschien eine umfangreiche, typografisch eigenwillig gestaltete Publikation mit Texten von Astrid von Asten, Raphaël Bouvier, Catherine Chevillot, Lilien Felder, Tessa Paneth-Pollak und Jana Teuscher in einer deutschen und einer englischen Version.
Raphaël Bouvier (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Rodin Arp. Riehen/Berlin (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 2020, 200 Seiten, CHF 67.00/€ 58.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
Illustration: Hans Arp «Ptolemäus III» (1961)/Auguste Rodin «Le Penseur» (1903/!966). (Bild aus der Ausstellung, © Jürg Bürgi, 2020).
Katja Aufleger im Museum Tinguely
01.12.20 10:56




Zur Ausstellung erschien ein raffiniert schlicht gestalteter Katalog, der das bisherige Schaffen von Katja Aufleger über die ausgestellten Werke hinaus umfassend dokumentiert. Die Publikation enthält Beiträge von Roland Wetzel, Lisa Marleen Grenzebach und Quinn Latimer.
Lisa Marleen Grenzebach (Hrsg. für das Museum Tinguely): Katja Aufleger, GONE. Basel/Berlin 2020 (Museum Tinguely/Distanz Verlag). 100 Seiten, CHF 28.00.
Als besonders nützlich erweist sich das Saalblatt, weil es die ausgestellten Objekte nicht nur erläutert, sondern auch beschreibt, wo sie im Museum zu finden sind.
Illustrationen: Porträt (© Andrzej Steinbach); «The Glow» (Filmstill, © Courtesy of the artist, Galerien Stampa, Basel, und Conradi, Hamburg). Bilder aus der Ausstellung: «Newton’s Cradle» und «And he tipped gallons oaf black in my favorite blue» (© Jürg Bürgi, 2020).
Taro Izumi im Museum Tinguely
03.09.20 15:18
Dem 1976 geborenen Konzeptkünstler Taro Izumi aus Japan widmet das Museum Tinguely – wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Kulturbetrieb mit ungeplanter Verspätung – vom 2. September bis zum 15. November 2020 die erste One-Man-Show in der Schweiz. Izumi gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern seines Landes. Typisch für ihn hat er das Ausstellungsprojekt in Basel zu einem guten Teil vor Ort und unter Einbezug der krisenhaften Aktualität konzipiert: Den Hauptraum beherrscht eine bis zur Decke reichende, einer Banksafe-Anlage oder einem Archiv ähnliche Konstruktion. Einige der rund 1500 Öffnungen sind geschlossen und mit einem kleinen Messingschild versehen. Darauf ist die Sitzreihe und die Nummer eines Theaterplatzes eingraviert. Hinter den offenen, bislang nicht vergebenen Fächern ist eine kleine Bühne zu erkennen und dahinter ein grosser leerer Zuschauerraum. Der Künstler erklärt, sein Werk sei eine Hommage an die Theater der Welt, in denen seit Monaten nicht gespielt werden darf und in deren Zuschauerräumen eine bleierne Stille herrscht. Er liess deshalb rund 3000 Bühnen anschreiben, sie sollten ihm Tonaufnahmen  dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)
dieser Stille im Zuschauerraum schicken. Um die 400 Theater gingen auf die Idee ein und stellten die gewünschten Tonkonserven zur Verfügung. Daraus mischte Izumis Team einen Klangteppich, der mit seinem aufdringlichen Rauschen die Halle füllt. (Weder Taro Izumi noch die Kuratorin haben wohl je von Heinrich Bölls satirischer Erzählung «Dr. Murkes gesammeltes Schweigen» gehört. Sie berichtet davon, wie Mitte der fünfziger Jahre, in der analogen Welt des Rundfunks, die Aufnahme eines Vortrags auf Veranlassung des Autors tiefgreifend neu geschnitten werden muss. Auf den am Schluss der Geschichte übrig bleibenden Tonbandresten ist nichts als rauschendes Schweigen zu hören.)
Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.
Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.
Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.
Konstruktionen aus Metall und Holz sollen es auch Otto und Lisa Normalverbraucher ermöglichen, die spektakulären Szenen nachzuempfinden. Das Konzept erinnert an einige hirnrissige Ideen Jean Tinguelys und seiner Freunde in der Gruppe der Nouveaux Réalistes, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Echoraum des Dadaismus die Erwartungen des kunstbeflissenen Publikums ad absurdum führten.
Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?
Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»
Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…
Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:
Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex
Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00
Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel

Auch weniger spektakuläre Arbeiten Taro Izumis nehmen die Wahrnehmung in den Fokus. Das geschieht zum Beispiel mit der Ausstellungs-Affiche mit dem Namen des Künstlers und dem Ausstellungstitel «Ex». Die riesigen Lettern wurden mit Bleistift auf die Wand gemalt und anschliessend teilweise wegradiert, sodass nun einige von ihnen mehr erahnt als gelesen werden können. Der schwarze Gummiabrieb wurde zusammengekehrt und zum Teil auch auf dem Boden verteilt – als Leitlinie durch die Ausstellung.
Anderswo setzt der Künstler Videotechnik ein. Und führt sie witzig ad absurdum: Auf einem geteilten Bildschirm ist zu sehen, wie jemand mit einem Finger in einen dicken Pfannkuchen drückt und dabei seine Weichheit erkundet. Gleich daneben wird in gleicher Absicht das Gesicht eines Säuglings bearbeitet – allerdings nicht direkt, sondern indirekt auf dem nachgiebigen Bildschirm eines Laptop-Computers, der die Druckstellen auf dem Gesicht des Babies simuliert.
Wie in diesem Fall ist es ratsam, genau hinzuschauen. Nur so wird die Fülle von Assoziationen und Signalen lesbar, die Taro Izumi bewegen. Besonders stolz ist das Museum, dass es die Werkgruppe «Tickled in a dream … maybe?» zeigen kann. Die erstmals 2017 in Paris präsentierte Gruppe von Skulpturen gibt vor, dass sportliche Aktionen – spektakuläre Fallrückzieher im Fussball zum Beispiel oder sensationelle Dunkings im Basketball – nicht nur grossartigen Ausnahmekönnern vorbehalten sind. Izumis prothesenartige

Es ist nicht der einzige Moment beim Rundgang durch die Izumi-Schau, wo sich ein Déjà-vu einstellt. Nur: Gilt das nicht auch für zahlreiche andere Kunst-Stücke anderer Künstler – in einer Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, wo alles möglich ist und, dank unbegrenzter technischer Möglichkeiten, alles Mögliche auch gemacht wird?
Insofern gehört Taro Izumi, der seine Ideen, wie heute nicht ungewöhnlich, von einem Mitarbeiterstab umsetzen lässt, in unsere Zeit. «Sein künstlerisches Vorgehen», schreibt Museumsdirektor Roland Wetzel wortreich im Vorwort zum Katalog, «orientiert sich an der Umgebung, in der er sich befindet, am jeweiligen Ort, an dem er sich physisch oder auch virtuell aufhält. Es umfasst als Material ein Spektrum von gefundenen Alltagsobjekten, beobachteten Handlungen bis hin zu medienkritischen Reflexionen und breitet sie in allen denkbaren künstlerischen Disziplinen aus. Izumis Wunderkammer ist die disparate Lebensrealität, die uns heute umgibt. Er überführt sie in neue Sinnbezüge und Zusammenhänge des scheinbaren Unsinns. Mit seinen ‹Bricolages› – dem genuin spielerischen Moment, das all seine Arbeiten auszeichnet – und seiner Offenheit für das Akzidentielle und Minderwertige erinnert an Tinguelys Kunstpraxis.»
Nicht nur dieser Abschnitt, auch andere Texte im Katalog zeugen vom weitgehend vergeblichen Bemühen, diese Art von Kunstschaffen fassbar zu machen. Man hat beim Lesen den Eindruck, da grabe jemand in einer grossen, mit statisch geladenem Styropor-Kügelchen gefüllten Pappschachtel nach dem eigentlichen Inhalt…
Zur Ausstellung gibt es einen Katalog:
Séverine Fromaigeat (Hrsg. für das Museum Tinguely): Taro Izumi. Ex
Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag) 168 Seiten, CHF 48.00/€ 40.00
Illustrationen: Still aus Video-Stream der Medienpräsentation am 31.8.2020 (oben), «Tickled in a dream … maybe?» (2017, Ausschnitt) © Jürg Bürgi, Basel
Pedro Reyes im Museum Tinguely: Return to Sender
23.06.20 15:31



Zur Ausstellung publizierte das Museum in einer englischen und einer deutschen Fassung in der Form eines Reglements der Schweizer Armee eine Broschüre, die ein ausführliches Interview von Roland Wetzel mit dem Künstler enthält.
Museum Tinguely (Hrsg.): Pedro Reyes. Return to Sender. (Basel, 2020) 26 Seiten.
Illustrationen: Porträt Pedro Reyes (Ausschnitt, Courtesy Lisson Gallery). Alle übrigen:
© Jürg Bürgi, Basel 2020 (Bilder aus der Ausstellung).
Das Museum Tinguely zelebriert «Amuse-Bouche, den Geschmack der Kunst»
21.02.20 14:42


Gleich daneben ist ein Raum der Eat-Art gewidmet, die von Daniel Spoerri (geb. 1930) bis heute mit Gusto angeführt wird. Seine «Fallenbilder», auf denen er die Überbleibsel von Mahlzeiten von Freunden und Freundinnen auf der Tischplatte festklebte und an die Wand hängte, gehören zum eisernen Bestand der Objektkunst des Nouveau Réalisme. Nicht fehlen darf in der Ausstellung auch Spoerris und Tony Morgans unvergesslich-witziger Kurzfilm «Resurrection», der – so Spoerri in seinen Erinnerungen – «zu Beginn einen frischen Kackhaufen in Grossaufnahme» zeigt, «der durch die Därme (Röntgenbild) in den Magen zurückkehrt, wo sich die gekauten Fleischstücke sammeln, die aus dem Mund als Steak herauskommen, das man rückwärtsgehend zum Metzger bringt, der es im Schlachthof wieder dem Ochsen anheftet, der am Schluss des Films, zu neuem Leben erweckt, auf einer sonnigen und blühenden Wiese grast und dabei natürlich einen grossen Fladen fallen lässt.»

Sieben Jahre zuvor hatte die Künstlerin in Bern für einen Freundeskreis – «zwei Frauen und drei Männer essen von einer nackten Frau» ein «Frühlingsfest» ausgerichtet. Die Künstlerin vergoldete Gesicht und Hals des mit einem Beruhigungsmittel in Schlaf versetzten Modells. Sie arrangierte, wie Ralf Beil in seinem Katalogbeitrag schreibt, allerlei Leckereien auf dem Körper – «beginnend mit dem Hors d’oeuvre auf Schenkeln und Unterleib, endend mit Himbeer- und Schokoladenschlagsahne auf den Brüsten.» Als er davon hörte, soll André Breton die befreundete Künstlerin um Erlaubnis gebeten haben, das Festessen im gleichen Jahr anlässlich der Ausstellung der EROS («Exposition InteRnatioOnale du Surréalisme») in der Galerie Cordier nachzustellen. Wie zahlreiche Bilder zeigen, fand der Event in der französischen Hauptstadt als Schickeria-Gaudi statt. Das üppig mit Speisen belegte Modell war mit einem Gazeanzug bedeckt, man bediente sich wie von einem kalten Buffet und ass mit Gabel und Messer von Tellern. Vom Frühlingskult, den Meret Oppenheim im Sinn gehabt hatte, war nichts zu spüren. Und glaubt man ihren Briefen, war ihr die auf die Zeit der Samurai zurück gehende japanische Tradition des Sushi-Essens von einem nackten Frauenkörper, Nyotaimori genannt, nicht bekannt. (Im Rahmen der Ausstellung soll das Frühlingsfest nun unter Mitwirkung von Chocolatier Fabian Rimann, Sensoriker Patrick Zbinden und Schauspielerin Sibylle Mumenthaler am 21. März 2020 im Museum Tinguely eine Neuauflage erleben.)

In der Fülle der Exponate ist uns, unter vielen anderen, die Arbeit des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh aufgefallen. Wo immer ausserhalb Afrikas eingeladen wird, braut er vor Ort nach Kontakten mit Menschen aus Afrika ein Schwarzbier, das «Sufferhead Original». Begleitet wird die «Basel Edition» von einem witzigen Kurzfilm, der geschickt mit Klischee-Vorstellungen spielt: Zwei Alphornbläser in Trachten musizieren vor einem eindrücklichen Bergpanorama und begeben sich in der Abenddämmerung zu einer Berghütte, wo sie zu ihrer grossen Überraschung auf eine fröhlich Schar dunkelhäutiger Menschen beim Fondue-Essen und Schwarzbier-Trinken treffen, die sie ohne Umstände zum mitmachen einladen, während draussen eine Herde brauner und weisser Schafe grasen.

Ja, es gibt sehr viel zu entdecken in dieser rundum anregenden und sorgfältig gestalteten Ausstellung. Wer tiefer in die Wissenschaft des Geschmacks und in den Geschmack der Kunst eindringen möchte, erhält mit der zur Ausstellung erschienenen Publikation, die nach einem einleitenden Aufsatz der Kuratorin das vorbereitende Symposium dokumentiert, einen weit gefassten Überblick über das Thema. (Das Taschenbuch ist in einer deutschen und einer englischen Version erhältlich.) Wer nicht so viel Aufwand treiben möchte, ist mit dem zweisprachigen Saaltext-Heft umfassend orientiert.
Museum Tinguely, Basel (Hrsg.): Amuse-bouche. Der Geschmack der Kunst. Mit Beiträgen von Antje Baecker, Ralf Beil, Marisa Benjamim, Felix Bröcker, Elisabeth Bronfen, Karin Leonhard, Thomas Macho, Wolfgang Meyerhof, Annja Müller-Alsbach, Jeannette Nuessli Guth, Maren Runte, Charles Spence, Daniel Spoerri, Paul Stoller, Roland Wetzel, Stefan Wiesner. Redaktion: Lisa Anette Ahlers. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag), 144 Seiten, EUR 28.00.
Illustrationen: Caspar de Crayer: Caritas Romana (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaspar_de_Crayer_-_Caritas_Romana_(Prado).jpg), Meret Oppenheim: Bon appétit, Marcel! © Pro Litteris, Zürich. Foto: Chris Puttere. Daniel Spoerri: Nur Geschmack anstatt Essen. Bild von der Verköstigung am Symposium Amuse-Bouche, 9. April 2019, Museum Tinguely (Scan aus der Publikation). Sam Taylor-Johnson: Still Life, 1991 (Filmstill), © Sam Taylor-Johnson, All Rights Reserved 2020 ProLitteris, Zürich.
100 Jahre, 20 visionäre Interieurs im Vitra Design Museum
08.02.20 11:54

Im zweiten Saal, der an fünf exemplarischen Interieurs den gesellschaftlichen Aufbruch seit den 1960er-Jahre vorführt, dominiert auf den ersten Blick die Kollektion des avantgardistischen Mailänder Designkollektivs Memphis, die der Modeschöpfer Karl Lagerfeld in seiner Wohnung in Monte Carlo von der Innenarchitektin Andrée Putman arrangieren liess. Die dreiste Farbigkeit der geometrischen Elemente und die an einen Boxring erinnernde Sitzlandschaft wirken wie eine dadaistische Provokation, ihr Gebrauchswert ist allerdings gering. Kein Wunder, liess Lagerfeld das Ensemble nach wenigen Jahren versteigern. Bis heute in Gebrauch ist hingegen das bereits in den ersten 1970er-Jahren vom japanischen Architekten Kisho Kurakawa errichtete Kapsel-Hotel in Tokio. Die einheitlich acht Quadratmeter grossen und 2,3 Meter hohen Zellen sind komplett eingerichtet. Beispielhaft für die Zeit – und darüber hinaus – war auch Andy Warhols «Silver Factory». Gebäude im New Yorker Stadtteil SoHo, die als Werk- und Lagerhallen ausgedient hatten, nutzten Künstler als Ateliers. Der exzentrische Andy Warhol liess 1964 eine ehemalige Hutfabrik an der East 47th Street komplett mit Silberfolie auskleiden und nutzte den weitläufigen Raum nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Wohnen und als Treffpunkt für seine bizarre Gefolgschaft.

Die im Saal 3 unter dem Rubrum «Natur und Technik» versammelten Wohnmodelle der 1950er-Jahre führen uns in die Welt des grenzenlosen Fortschrittsglaubens: Ernstgemeint und unkritisch im «House of the Future» der «Ideal Home Exhibition» in London 1956, witzig veralbert in Jacques Tatis Film «Mon Oncle» über die voll automatisierte «Villa Arpel». Andere Konzepte, Innen und Aussen, Interieur und Natur zu verbinden, wirkten weit nachhaltiger. Am radikalsten ging Bernard Rudofsky (1905-1988) in seinem Wohngarten für den Bildhauer Costantino Nivola vor, in dem er freistehende Wände und – als Wohnraum – eine Pergola aufstellte, die im Sommer von Glyzinien überwuchert war. Weniger radikal versuchte die brasilianische Architektin Lina Bo Bardi 1953 ihre «Casa de Vidro» in die «natürliche Ordnung» einzufügen, indem sie die Fenster bis zum Fussboden zog und damit die Natur ins Haus holte.
Einzigartig war das allerdings nicht, wie im vierten Raum augenfällig wird, wo Ludwig Mies van der Rohes (1886-1969) Brünner «Villa Tugendhat» präsentiert wird. Als der letzte Direktor des Bauhauses 1928 den Auftrag für den Bau erhielt, erfüllte sich der Traum jedes Architekten: Das Hang-Grundstück in einem Villenquartier der mährischen Hauptstadt war riesig, die Begeisterung der Auftraggeber für seine Ideen fast grenzenlos, und ihre finanziellen Ressourcen ebenso. Das machte es möglich, dass Mies nicht nur konstruktiv Neuland betreten konnte, indem er als Tragkonstruktion ein Stahlskelett wählte, sodass den Wänden keine statische Funktion mehr zukam. So konnte er zum Park hin vom Boden bis zur Decke Glasfronten einbauen, die zudem versenkbar waren, sodass die dahinter liegenden Räume im Sommer zu einer Art Balkon werden konnten. Die Errungenschaften der

Besonders interessant an der aktuellen Ausstellung des Vitra Design Museums sind die Querbezüge, die über die Zeitspanne von hundert Jahren sichtbar werden. Es gibt Wohnwelten, die von 1920 bis heute allgemein als zeitgenössisch akzeptiert sind, und andere, die höchstens individuell als wertvoll gelten. Kritisch ist anzumerken, dass das gleichwertige Nebeneinander der beiden Konzepte – der von Wenigen als lebenswert empfundenen Wohnwelten und den von Vielen allgemein anerkannten Prinzipien – einen Eindruck von Beliebigkeit vermittelt, als hätten die Ausstellungsmacher selten gezeigte Stücke aus der Sammlung wieder einmal herzeigen wollen. Der Katalog, der ein viel breiteres Spektrum von beispielhaften Interieurs abdeckt, ist geeignet, diesen Eindruck zu korrigieren.
Die Ausstellung wird begleitet von einer Fülle von Führungen, Vorträgen, Workshops und Diskussionen. Das Programm steht auf der Website des Museums und hier zur Verfügung.
Den Katalog zur Ausstellung gibt es in einer deutschen und einer englischen Version.
Kries, M., Eisenbrand, J. (Hrsg.): Home Stories. 100 Jahre, 20 visionäre Interieurs.
Mit Beiträgen von Jochen Eisenbrand, Joseph Grima, Anna-Mea Hoffmann, Jasper Morrison, Matteo Pirola, Alice Rawsthorn, Timothy Rohan, Penny Sparke, Adam Štěch, and Mark Taylor; Interviews mit Nacho Alegre, Charlap Hyman & Herrero, Ilse Crawford, Sevil Peach u.a.
Weil am Rhein 2020 (Vitra Design Museum), 320 Seiten, €59.90.
Illustrationen: Oben: Ausstellungssignet (Casa de Video), Mitte: Verner Panton, Phantasy Landscape. Unten: Villa Tugendhat, Gartenfront. Foto © Jürg Bürgi, Basel 2020.
Edward Hopper in der Fondation Beyeler: Ein neuer Blick auf Landschaft
25.01.20 11:56
Edward Hopper (1882-1967), dem Erfinder verstörender, mit wartenden Menschen besetzter amerikanischer Interieurs, widmet die Fondation Beyeler vom 26. Januar bis (dank der Corona-Pandemie) 26. Juli 2020 eine grosse Einzelausstellung. Überraschend hat sie aber nicht, wie zu erwarten wäre, die Beklemmung im Fokus, welche die Bilder des gelernten Gebrauchsgrafikers evozieren, vielmehr stellt Kurator Ulf Küster (In Zusammenarbeit mit dem New Yorker «Whitney Museum of American Art») unter dem Titel «Ein neuer Blick auf Landschaft» die Darstellungen der Natur – Wald, Wiesen, Wasser – in den Mittelpunkt.  Ausgehend von dem als Dauerleihgabe dem Museum anvertrauten Gemälde «Cape Ann Granite» von 1928 führt der thematisch angelegte Parcours an kraftvoll gemalten Ansichten aus den Neuengland-Staaten vorbei. Während auf einem Teil der insgesamt 65 Exponate aus den Jahren 1909 bis 1965 die unberührte Natur die Hauptrolle spielt, ist auf anderen die menschliche Präsenz offenkundig – auch wenn sie nicht offen in Erscheinung tritt: Strassen, Häuser, Telegrafenmasten, Eisenbahnen, Autos zeugen von Eingriffen des Menschen. Ganz auf Personen verzichten, mochten die Ausstellungsmacher allerdings nicht. Das Spätwerk «Cape Cod Morning» von 1950, das eine Frau in erwartungsvoller Haltung im Erker eines traditionellen Holzhauses zeigt, ist prominent auf der Rückseite des Katalogs platziert. Und auch die beklemmend-einsame Mobil-Tankstelle («Gas», 1940) auf der Umschlag-Vorderseite ist belebt. Der Besitzer, offenbar schon für den Feierabend umgezogen, ordnet in der Abenddämmerung die Schläuche, um danach seinen Betrieb zu schliessen und das Licht zu löschen. Das Bild, nicht nach der Natur wie viele andere, sondern aus der Beobachtung mehrerer Tankstellen rund um den Ferienort Truro in Massachusetts gemalt, ist beispielhaft für die Art, wie Hopper
Ausgehend von dem als Dauerleihgabe dem Museum anvertrauten Gemälde «Cape Ann Granite» von 1928 führt der thematisch angelegte Parcours an kraftvoll gemalten Ansichten aus den Neuengland-Staaten vorbei. Während auf einem Teil der insgesamt 65 Exponate aus den Jahren 1909 bis 1965 die unberührte Natur die Hauptrolle spielt, ist auf anderen die menschliche Präsenz offenkundig – auch wenn sie nicht offen in Erscheinung tritt: Strassen, Häuser, Telegrafenmasten, Eisenbahnen, Autos zeugen von Eingriffen des Menschen. Ganz auf Personen verzichten, mochten die Ausstellungsmacher allerdings nicht. Das Spätwerk «Cape Cod Morning» von 1950, das eine Frau in erwartungsvoller Haltung im Erker eines traditionellen Holzhauses zeigt, ist prominent auf der Rückseite des Katalogs platziert. Und auch die beklemmend-einsame Mobil-Tankstelle («Gas», 1940) auf der Umschlag-Vorderseite ist belebt. Der Besitzer, offenbar schon für den Feierabend umgezogen, ordnet in der Abenddämmerung die Schläuche, um danach seinen Betrieb zu schliessen und das Licht zu löschen. Das Bild, nicht nach der Natur wie viele andere, sondern aus der Beobachtung mehrerer Tankstellen rund um den Ferienort Truro in Massachusetts gemalt, ist beispielhaft für die Art, wie Hopper  in seinen Gemälden Geschichten, nein, nicht erzählt, sondern bloss anreisst. Er stellt eine Szenerie und ihre Stimmung zur Verfügung und überlässt den Betrachtenden alles Weitere. Der Amerika-affine Filmemacher Wim Wenders (z.B.. «Paris Texas», «Don’t Come Knocking») machte sich diese Offenheit in seinem Ausstellungsbeitrag, dem 3D-Kurzfilm «Two or Three Things I Know about Edward Hopper» zunutze, indem er sich von Stimmungen und Motiven in Bildern Hoppers inspirieren liess und sie zu einer ebenso handlungsarmen, im Vagen balancierenden eigenen Geschichte destillierte. Auch Alfred Hitchcock ( zum Beispiel in «Psycho») und andere Protagonisten des amerikanischen Kinos liessen sich direkt von Hopper inspirieren. Und im Roman «Lolita» von Vladimir Nabokov gibt es eine Szene, die direkt Bezug auf Hoppers Tankstellen-Bild «Gas» Bezug nimmt, wie der Literaturwissenschaftler Will Norman 2013 in einem Vortrag feststellte (https://journals.openedition.org/transatlantica/8462): «We had stopped at a gas station, under the sign of Pegasus, and [Lolita] had slipped out of her seat and escaped to the rear of the premises while the raised hood, under which I had bent to watch the mechanic's manipulations, hid her for a moment from my sight».
in seinen Gemälden Geschichten, nein, nicht erzählt, sondern bloss anreisst. Er stellt eine Szenerie und ihre Stimmung zur Verfügung und überlässt den Betrachtenden alles Weitere. Der Amerika-affine Filmemacher Wim Wenders (z.B.. «Paris Texas», «Don’t Come Knocking») machte sich diese Offenheit in seinem Ausstellungsbeitrag, dem 3D-Kurzfilm «Two or Three Things I Know about Edward Hopper» zunutze, indem er sich von Stimmungen und Motiven in Bildern Hoppers inspirieren liess und sie zu einer ebenso handlungsarmen, im Vagen balancierenden eigenen Geschichte destillierte. Auch Alfred Hitchcock ( zum Beispiel in «Psycho») und andere Protagonisten des amerikanischen Kinos liessen sich direkt von Hopper inspirieren. Und im Roman «Lolita» von Vladimir Nabokov gibt es eine Szene, die direkt Bezug auf Hoppers Tankstellen-Bild «Gas» Bezug nimmt, wie der Literaturwissenschaftler Will Norman 2013 in einem Vortrag feststellte (https://journals.openedition.org/transatlantica/8462): «We had stopped at a gas station, under the sign of Pegasus, and [Lolita] had slipped out of her seat and escaped to the rear of the premises while the raised hood, under which I had bent to watch the mechanic's manipulations, hid her for a moment from my sight».
Wim Wenders und Kurator Ulf Küster kamen an der Medien-Präsentation der Ausstellung mehrfach auf den «Sog» zu sprechen, den Hoppers Bilder auf die Betrachtenden ausübten. Tatsächlich ist diese Wirkung vor allem den Darstellungen zuzuschreiben, in denen Menschen präsent sind. Aber auch Hoppers anscheinend von dunklen Geheimnissen erfüllten Wäldern ist diese Faszination eigen. Tatsächlich hat sich der Maler Zeit seines Lebens intensiv mit der menschlichen Psyche befasst. Er las die Schriften von C.G. Jung und Sigmund Freud und beschäftigte sich mit seinen eigenen Handicaps, darunter eine immer wieder auftretende Mal-Hemmung. «Kunst», schrieb Hopper 1939 in einem Brief, «ist in so hohem Mass ein Ausdruck des Unbewussten, dass mir scheint, dass sie dem Unbewussten das Wichtigste verdankt und das Bewusstsein nur eine untergeordnete Rolle spielt.»
Zur Ausstellung erschien ein Katalog in deutscher und englischer Version mit Texten von Erika Doss, Ulf Küster, David Rubin und Katharina Rüppell.
Küster, U. (Hrsg.): Edward Hopper. Ein neuer Blick auf Landschaft. Riehen/Berlin 2020 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 148 Seiten € 58/CHF 62.50.
Kurator Ulf Küster schrieb zudem eine Hopper-Monografie.
Küster, U. Edward Hopper: A – Z. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag)120 Seiten, 40 Abb. € 18.00/CHF 19.90.
Illustrationen: Cape Ann Granite (1928) © Heirs of Josephine Hopper/2019 ProLitteris, Zürich. Foto: Christie’s (oben)
Gas (1940) © Heirs of Josephine Hopper/2019 ProLitteris, Zürich. Foto: ©2019 Digital Image. The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence.


Wim Wenders und Kurator Ulf Küster kamen an der Medien-Präsentation der Ausstellung mehrfach auf den «Sog» zu sprechen, den Hoppers Bilder auf die Betrachtenden ausübten. Tatsächlich ist diese Wirkung vor allem den Darstellungen zuzuschreiben, in denen Menschen präsent sind. Aber auch Hoppers anscheinend von dunklen Geheimnissen erfüllten Wäldern ist diese Faszination eigen. Tatsächlich hat sich der Maler Zeit seines Lebens intensiv mit der menschlichen Psyche befasst. Er las die Schriften von C.G. Jung und Sigmund Freud und beschäftigte sich mit seinen eigenen Handicaps, darunter eine immer wieder auftretende Mal-Hemmung. «Kunst», schrieb Hopper 1939 in einem Brief, «ist in so hohem Mass ein Ausdruck des Unbewussten, dass mir scheint, dass sie dem Unbewussten das Wichtigste verdankt und das Bewusstsein nur eine untergeordnete Rolle spielt.»
Zur Ausstellung erschien ein Katalog in deutscher und englischer Version mit Texten von Erika Doss, Ulf Küster, David Rubin und Katharina Rüppell.
Küster, U. (Hrsg.): Edward Hopper. Ein neuer Blick auf Landschaft. Riehen/Berlin 2020 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 148 Seiten € 58/CHF 62.50.
Kurator Ulf Küster schrieb zudem eine Hopper-Monografie.
Küster, U. Edward Hopper: A – Z. Berlin 2020 (Hatje Cantz Verlag)120 Seiten, 40 Abb. € 18.00/CHF 19.90.
Illustrationen: Cape Ann Granite (1928) © Heirs of Josephine Hopper/2019 ProLitteris, Zürich. Foto: Christie’s (oben)
Gas (1940) © Heirs of Josephine Hopper/2019 ProLitteris, Zürich. Foto: ©2019 Digital Image. The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence.
Len Lye, der «Mouvemnet Composer», im Musem Tinguely
25.10.19 15:05
Das Museum Tinguely in Basel wird einmal mehr seinem Ruf gerecht, den Horizont seines Publikums mit sorgfältig präparierten Überraschungen zu erweitern: Vom 23. Oktober bis zum 26. Januar 2020 präsentiert das Haus eine umfassende Schau auf das in Europa kaum bekannte Werk des aus Neuseeland stammenden Multimedia-Avantgardisten Len Lye (1901-1980). Unter dem Titel «Len Lye – Motion Composer» sind, chronologisch geordnet, im Erdgeschoss des Mario-Botta-Baus über 150 Werke des Trickfilm-Pioniers und Kinetikers zu sehen. Schon im Vorraum steckt Kurator Andres Pardey den Rahmen zwischen Film und kinetischer Skulptur ab. Das grazil schwingende Bündel feiner Stahlstäbe von «Fountain» steht im Vordergrund und dahinter läuft der 1959 im Auftrag der UNO gedrehte Film «Fountain of Hope». Die Skulptur gehört zu Len Lyes bekanntesten Werken – nicht zuletzt, weil es davon mehrere Varianten gibt. Sie wurde im Frühling 1961 im Amsterdamer Stedelijk Museum in der epochemachenden Ausstellung «Bewogen Beweging» von Pontus Hultén gezeigt, die der kinetischen Kunst zum Durchbruch verhalf. Jean Tinguely war in der 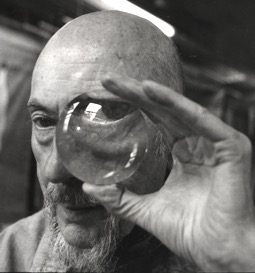 Schau, die noch im gleichen Jahr nach Stockholm und später ins dänische Humlebæk weiter zog, mit nicht weniger als 28 Werken präsent. Die gemeinsamen Interessen von Lye und Tinguely für die kinetische Kunst, die Breite ihres Werks von feingliedrigen Konstruktionen bis zu monumentalen Formaten, ihr Interesse für performative Elemente, Theater und Film seien für ihn der Ausgangspunkt der Arbeit an der Ausstellung gewesen, wird Andres Pardey in einem Pressetext zitiert. Und Evan Webb, Direktor der Len Lye Foundation meinte: Tinguely und Lye repräsentierten «die entgegengesetzten Enden der kinetischen Kunst». Es sei deshalb von grossem Wert, die beiden wichtigen Künstler zusammen zu zeigen.
Schau, die noch im gleichen Jahr nach Stockholm und später ins dänische Humlebæk weiter zog, mit nicht weniger als 28 Werken präsent. Die gemeinsamen Interessen von Lye und Tinguely für die kinetische Kunst, die Breite ihres Werks von feingliedrigen Konstruktionen bis zu monumentalen Formaten, ihr Interesse für performative Elemente, Theater und Film seien für ihn der Ausgangspunkt der Arbeit an der Ausstellung gewesen, wird Andres Pardey in einem Pressetext zitiert. Und Evan Webb, Direktor der Len Lye Foundation meinte: Tinguely und Lye repräsentierten «die entgegengesetzten Enden der kinetischen Kunst». Es sei deshalb von grossem Wert, die beiden wichtigen Künstler zusammen zu zeigen.
Dass Lye eine seiner Skulpturen in einem Film auftreten liess, war allerdings eine Ausnahme. Der vielfältig künstlerisch begabte Neuseeländer, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, zeichnete viel und stellte sich dabei vor, dass man nicht nur Musik, sondern auch Bewegungen komponieren könnte. Seine erste künstlerische Ausbildung erhielt er in der Heimat. Später brachte ein Aufenthalt in Samoa den wenig mehr als Zwanzigjährigen in Kontakt mit der Kunst von Ureinwohnern, was ihn tief beeindruckte. In Sydney, wo er 1922 bis 1926 lebte, entstand das Totem und Tabu-Skizzenbuch, das als Faksimile einen der drei Teile des Katalogs darstellt. «Totem und Tabu», Sigmund Freuds Auseinandersetzung mit dem «Seelenleben der Wilden und der Neurotiker» aus dem Jahr 1913 half Lye den Zugang zur indigenen Kunst der Maori, der Samoaer, der Aborigines, aber auch afrikanischer Völker zu finden. In der Ausstellung hängen gross- und kleinformatige Gemälde mit Motiven aus diesem Fundus, und der Zeichentrickfilm «Tusalava» veranschaulicht eindrücklich die inspirierende Kraft dieser Zeichnungen.
1926 zog Lye von Sydney nach London. Die Überfahrt finanzierte er, indem er einem Seemann für fünf Pfund die Papiere abkaufte und als Heizer auf dem Dampfer Euripides anheuerte. In der britischen Hauptstadt begann er als Bühnenarbeiter, und im Jahr darauf ist er bei einer Produktionsfirma für Werbe-Trickfilme beschäftigt und lernt das die Grundlagen des Animationsfilms. 1928 gehörte er zur Künstlergruppe «Seven and Five Society». Mitglieder der 1919 gegründeten Vereinigung waren sieben Maler und fünf Bildhauer, darunter ab 1924, als sie sich avantgardistisch ausrichtete, Ben Nicholson (1894-1982), Henry Moore (1898-1986) und Barbara Hepworth (1903-1975). Als Mitglied des exklusiven Klubs etablierte sich der Neuseeländer in der Avantgarde, die enge Beziehungen zu den europäischen Modernisten pflegte. Seinen Ruf als feste Grösse festigte er durch seine vielseitigen künstlerischen Interessen: er zeichnete und skizzierte «Doodles», er malte abstrakte Bilder nach Motiven der Stammeskunst, er entwarf Buchumschläge und befasste sich intensiv mit den handwerklichen Erfordernissen der Buchgestaltung, und er erfand – 1932 – die neue Technik der «Drawn-on-film animation».
 Die Ausstellung präsentiert mehrere dieser innovativen Werke, die alle durch ihre fröhliche Farbigkeit und ihren mit der Begleitmusik koordinierten Rhythmus brillieren. Für uns Heutige ist es erstaunlich, dass grosse Konzerne, darunter der Ölmulti Shell und Regierungsstellen wie die Britische Postverwaltung diese Experimente finanzierten. Sie erhielten dafür ganz ungewöhnliche Werbefilme, die in den Vorprogrammen der Kinos ein Millionenpublikum erreichten. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs produzierte Lye Propagandafilme für die britische Regierung und schrieb sein Kunst-Manifest «A Definition of Common Purpose».
Die Ausstellung präsentiert mehrere dieser innovativen Werke, die alle durch ihre fröhliche Farbigkeit und ihren mit der Begleitmusik koordinierten Rhythmus brillieren. Für uns Heutige ist es erstaunlich, dass grosse Konzerne, darunter der Ölmulti Shell und Regierungsstellen wie die Britische Postverwaltung diese Experimente finanzierten. Sie erhielten dafür ganz ungewöhnliche Werbefilme, die in den Vorprogrammen der Kinos ein Millionenpublikum erreichten. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs produzierte Lye Propagandafilme für die britische Regierung und schrieb sein Kunst-Manifest «A Definition of Common Purpose».
1944 reiste Lye auf Einladung des Dokumentarfilmers Richard de Rochemont in die USA, um einige Kurzfilme zu machen. Fortan lebte und arbeitete er in den USA, vor allem in New York, wo er Trickfilme produzierte und an mehreren Universitäten als Dozent wirkte. 1947 übertrug er die Idee des kameralosen Films auf die Fotografie und schuf eine Serie von Fotogrammen, mit denen er seine Freundinnen und Freunde aus der Kunstszene in Szene setzte. Mit dem preisgekrönten, in schwarzen Vorspannstreifen gekratzten «Free Radicals» beendete Lye seine Karriere als Experimentalfilmer. Fortan fokussierte er auf die Gestaltung von «Tangible Motion Sculptures» oder kurz «Tangibles», wie er seine kinetischen Skulpturen nannte. Sie bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung im Museum Tinguely. Die faszinierenden, von Elektromotoren angetriebenen programmierte Bewegungsabläufe zeigenden Maschinen, von denen er in kurzer Zeit etwa 20 verschiedene Modell skizzierte, erfüllten für ihn den Traum vom «Malen mit Bewegung». Ihre sorgfältig, mit Unterstützung von Ingenieuren gestalteten Bewegungsabläufe erinnern mit schnellen und ruhigen Phasen an musikalischen Kompositionen oder ein Ballett auf einer Bühne. Lye veränderte seine ersten Entwürfe und verfeinerte die Abläufe und vor allem das Format, das er sich meist sehr gross vorstellte. Zu Lebzeiten – Len Lye starb 1980 an Leukämie – blieben diese Ideen aus Mangel an technischem Know-how und an finanziellen Mitteln liegen. Später begannen Ingenieure im Auftrag der Lye-Foundation in Neuseeland damit, die Visionen des Künstlers umzusetzen.
Alles in allem ist die Ausstellung «Len Lye – Motion Composer» ein grossartiges Highlight des Basler Kunst-Herbsts und -Winters. Es lohnt sich, genügend Zeit einzuplanen, um die Filme und die Maschinen-Skulpturen anzusehen und auch die zahlreichen andern Werke zu würdigen.
Zur Ausstellung erschien, in einer deutschen und einer englischen Version eine Publikation in drei Bänden. Der erste ist als Faksimile des «Totem & Taboo Sketchbook» gestaltet, der zweite ist als Werkkatalog konzipiert und im dritten Teil sind Texte über die Ausstellung und über das Werk von Len Lye versammelt. Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Len Lye – Motion Composer. Heidelberg 2019 (Kehrer Verlag). CHF 58.00 (im Museumsshop und online.
Illustrationen: Oben Len Lye 1979, © Robert Del Tredici, Copyright Visual Arts-Cova-Daav, 2019. Unten: Filmstill aus «A Colour Box»1935 © Courtesy Len Lye Foundation.
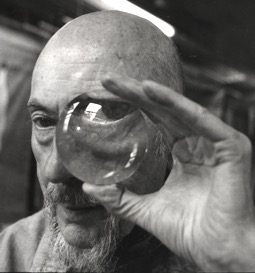
Dass Lye eine seiner Skulpturen in einem Film auftreten liess, war allerdings eine Ausnahme. Der vielfältig künstlerisch begabte Neuseeländer, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, zeichnete viel und stellte sich dabei vor, dass man nicht nur Musik, sondern auch Bewegungen komponieren könnte. Seine erste künstlerische Ausbildung erhielt er in der Heimat. Später brachte ein Aufenthalt in Samoa den wenig mehr als Zwanzigjährigen in Kontakt mit der Kunst von Ureinwohnern, was ihn tief beeindruckte. In Sydney, wo er 1922 bis 1926 lebte, entstand das Totem und Tabu-Skizzenbuch, das als Faksimile einen der drei Teile des Katalogs darstellt. «Totem und Tabu», Sigmund Freuds Auseinandersetzung mit dem «Seelenleben der Wilden und der Neurotiker» aus dem Jahr 1913 half Lye den Zugang zur indigenen Kunst der Maori, der Samoaer, der Aborigines, aber auch afrikanischer Völker zu finden. In der Ausstellung hängen gross- und kleinformatige Gemälde mit Motiven aus diesem Fundus, und der Zeichentrickfilm «Tusalava» veranschaulicht eindrücklich die inspirierende Kraft dieser Zeichnungen.
1926 zog Lye von Sydney nach London. Die Überfahrt finanzierte er, indem er einem Seemann für fünf Pfund die Papiere abkaufte und als Heizer auf dem Dampfer Euripides anheuerte. In der britischen Hauptstadt begann er als Bühnenarbeiter, und im Jahr darauf ist er bei einer Produktionsfirma für Werbe-Trickfilme beschäftigt und lernt das die Grundlagen des Animationsfilms. 1928 gehörte er zur Künstlergruppe «Seven and Five Society». Mitglieder der 1919 gegründeten Vereinigung waren sieben Maler und fünf Bildhauer, darunter ab 1924, als sie sich avantgardistisch ausrichtete, Ben Nicholson (1894-1982), Henry Moore (1898-1986) und Barbara Hepworth (1903-1975). Als Mitglied des exklusiven Klubs etablierte sich der Neuseeländer in der Avantgarde, die enge Beziehungen zu den europäischen Modernisten pflegte. Seinen Ruf als feste Grösse festigte er durch seine vielseitigen künstlerischen Interessen: er zeichnete und skizzierte «Doodles», er malte abstrakte Bilder nach Motiven der Stammeskunst, er entwarf Buchumschläge und befasste sich intensiv mit den handwerklichen Erfordernissen der Buchgestaltung, und er erfand – 1932 – die neue Technik der «Drawn-on-film animation».

1944 reiste Lye auf Einladung des Dokumentarfilmers Richard de Rochemont in die USA, um einige Kurzfilme zu machen. Fortan lebte und arbeitete er in den USA, vor allem in New York, wo er Trickfilme produzierte und an mehreren Universitäten als Dozent wirkte. 1947 übertrug er die Idee des kameralosen Films auf die Fotografie und schuf eine Serie von Fotogrammen, mit denen er seine Freundinnen und Freunde aus der Kunstszene in Szene setzte. Mit dem preisgekrönten, in schwarzen Vorspannstreifen gekratzten «Free Radicals» beendete Lye seine Karriere als Experimentalfilmer. Fortan fokussierte er auf die Gestaltung von «Tangible Motion Sculptures» oder kurz «Tangibles», wie er seine kinetischen Skulpturen nannte. Sie bilden den zweiten Schwerpunkt der Ausstellung im Museum Tinguely. Die faszinierenden, von Elektromotoren angetriebenen programmierte Bewegungsabläufe zeigenden Maschinen, von denen er in kurzer Zeit etwa 20 verschiedene Modell skizzierte, erfüllten für ihn den Traum vom «Malen mit Bewegung». Ihre sorgfältig, mit Unterstützung von Ingenieuren gestalteten Bewegungsabläufe erinnern mit schnellen und ruhigen Phasen an musikalischen Kompositionen oder ein Ballett auf einer Bühne. Lye veränderte seine ersten Entwürfe und verfeinerte die Abläufe und vor allem das Format, das er sich meist sehr gross vorstellte. Zu Lebzeiten – Len Lye starb 1980 an Leukämie – blieben diese Ideen aus Mangel an technischem Know-how und an finanziellen Mitteln liegen. Später begannen Ingenieure im Auftrag der Lye-Foundation in Neuseeland damit, die Visionen des Künstlers umzusetzen.
Alles in allem ist die Ausstellung «Len Lye – Motion Composer» ein grossartiges Highlight des Basler Kunst-Herbsts und -Winters. Es lohnt sich, genügend Zeit einzuplanen, um die Filme und die Maschinen-Skulpturen anzusehen und auch die zahlreichen andern Werke zu würdigen.
Zur Ausstellung erschien, in einer deutschen und einer englischen Version eine Publikation in drei Bänden. Der erste ist als Faksimile des «Totem & Taboo Sketchbook» gestaltet, der zweite ist als Werkkatalog konzipiert und im dritten Teil sind Texte über die Ausstellung und über das Werk von Len Lye versammelt. Pardey, A. (Hrsg. für das Museum Tinguely): Len Lye – Motion Composer. Heidelberg 2019 (Kehrer Verlag). CHF 58.00 (im Museumsshop und online.
Illustrationen: Oben Len Lye 1979, © Robert Del Tredici, Copyright Visual Arts-Cova-Daav, 2019. Unten: Filmstill aus «A Colour Box»1935 © Courtesy Len Lye Foundation.
Rebecca Horns «Körperphantasien» im Museum Tinguely
06.06.19 15:30



Die Ausstellung im Museum Tinguely zeigt die künstlerische Welt einer poetischen Erfinderin, die zu ihren Objekten jederzeit ironisch Distanz hält. Die Auswahl der Werke und ihre sorgfältige Präsentation widerspiegeln sowohl die Kennerschaft als auch die Freude, mit der die Kuratorin eine rundum gelungene Präsentation realisierte.

Am 6. und 12. Juni 2019 zeigt das Stadtkino Basel drei Spielfilme von Rebecca Horn. Die Schauspielerin Michaela Wendt trägt am 9. und 23. Juni, sowie am 7. Juli, 25. August und 8. und 22. September jeweils um 10 Uhr zu den Werken passende Texte vor. (Details auf der Website des Museums.)
Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Ausgabe – ein sehr sorgfältig gestalteter Katalog. Reimann, Sandra B. (Hrsg. für das Museum Tinguely, Basel): Rebecca Horn – Körperphantasien. Wien 2019 (Verlag für moderne Kunst), 160 Seiten, CHF 42.00, € 38.00.
Illustrationen von oben nach unten: Weisser Körperfächer (1972, Filmstill), Schmetterling im Zenit (2009), Bleistiftmaske (1973, Filmstill), Handschuhfinger (1972) © 2019 Rebecca Horn/Pro Litteris, Zürich.
Rudolf Stingel in der Fondation Beyeler
24.05.19 18:28



Zur Ausstellung erschien ein Künstlerbuch. Es besteht ausschliesslich aus Abbildungen von einzelnen Werken und Installationen, deren Abfolge Rudolf Stingel selbst bestimmt hat.
Kittelmann, U. (Hrsg. für die Fondation Beyeler, Riehen/Basel): Rudolf Stingel. Berlin 2019 (Hatje Cantz Verlag), 380 Seiten, CHF 65.00/€ 58.00
Illustrationen aus der Ausstellung. © 2019, Jürg Bürgi, Basel. Unten: Untitled (2018) © Rudolf Stingel, Foto: John Lehr.
«Kosmos Kubismus – Von Picasso bis Léger» im Kunstmuseum Basel
22.05.19 10:03



Soll man es bedauern oder sich darüber freuen: Wer den «Kosmos Kubismus» im Basler Kunstmuseum betritt, muss nicht, wie in der fast gleichzeitig in der Fondation Beyeler in Riehen stattfindenden Ausstellung «Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode» (Besprechung hier) befürchten, an der Kasse Schlange stehen zu müssen und im Innern wegen der Menge der Besucherinnen und Besucher nur hin und wieder einen Blick auf die Kunstwerke erhaschen zu können. Insgesamt muss man – ohne der grossartigen Schau der Fondation Beyeler Unrecht zu tun – der klug arrangierten und in ihrer Fülle überwältigenden Präsentation des Kunstmuseums die nachhaltigere Wirkung zubilligen. Während der Publikumsmagnet in Riehen ohne Zweifel eine grosse kulinarische Wirkung entfaltet, wird die anspruchsvolle historische Präsentation des Kunstmuseums – wie vor knapp 30 Jahren «Die Geburt des Kubismus» – als einzigartiges Erlebnis noch lange nach ihrem Ende nachwirken.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier im Archiv zu finden.
Der Katalog zur Ausstellung ist eine adaptierte und übersetzte Fassung der Schau im Centre Pompidou, Paris (Herbst/Winter 2018/19).
Léal, B., Briend, Ch., Coulondre, A., Helfenstein, J., Reifert E.: Kosmos Kubismus. Von Picasso bis Léger. München 2019 (Firmer Verlag) 320. Seiten, CHF 49.00/ €49.90.
Illustrationen von oben nach unten: Georges Braque: Der Portugiese (1911/12); Sonia Delaunay: Elektrische Prismen (1914); Fernand Lager: Die Treppe (1914).
Lois Weinbergers «Debris Field» im Museum Tinguely
16.04.19 16:58



Auf Einladung des Museums Tinguely realisierte die in Riehen lebende Künstlerin Nadine Cueni, geb. 1976, unter dem Titel «des hirondelles» einen filmischen Essai über den am 23. August 1986 durch einen Blitzschlag und die folgende Feuersbrunst vollständig zerstörten Bauernhof der Familie Dafflon in Neyruz. Jean Tinguely, der als Nachbar die Katastrophe miterlebte, baute aus den Trümmern von Landmaschinen der Familie Dafflon seinen «Mengele-Totentanz». Cueni hat in Neyruz mit Bauernsohn Benoît Dafflon und anderen Zeitzeugen gesprochen und sie über das Feuer und den Nachbar Tinguely sprechen lassen. Nicht überraschend ist auch hier in Erinnerungen und Anekdoten der überlieferte Aberglaube gegenwärtig. Der knapp einstündige Film, französisch mit deutschen Untertiteln, läuft im Vorraum von «Debris Field».
Zur Ausstellung von Lois Weinberger erschien ein schön illustrierter Katalog (Englisch und Deutsch), der sich an die anlässlich der documenta 14 erschienene, inzwischen vergriffene Publikation «Debris Field – Erkundungen im Abgelebten, 2010-2016» anlehnt. Er enthält einen poetischen Text von Lois Weinberger und Beiträge von Roland Wetzel und Adam Szmyczyk. Wetzel, R. (Hrsg.): Lois Weinberger. Debris Field. Erkundungen im Abgelebten. 36 Seiten CHF 14.00 im Museumsshop.
Illustrationen: Porträt Lois Weinberger © Jürg Bürgi, 2019. Lois Weinberger: Debris Field, 2010-2016, Dachbodenfunde. Elternhaus Stams in Tirol, 14. bis 20. Jahrhundert. Foto Paris Tsitsos © Studio Weinberger
Cyprien Gaillard im Museum Tinguely
16.02.19 16:16
Unter dem nicht weiter erläuterten Titel «Roots Canal» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 16. Februar bis 5. Mai 2019 eine skulpturale Installation sowie zwei Filmarbeiten von Cyprien Gaillard. Den 1980 in Paris geborenen und teilweise in Kalifornien aufgewachsenen Franzosen, der sein Kunststudium 2005 in Lausanne mit einem Diplom abschloss, hält Museumsdirektor Roger Wetzel für «einen der interessantesten Künstler seiner Generation». Im Mittelpunkt der von Séverine Fromaigeat kuratierten Schau steht ein Ensemble von Baggerschaufeln verschiedener Grösse. Die penibel ausgerichteten Baugeräte, sauber geputzt und sorgfältig geölt, repräsentieren Gaillards Interesse an «Zerstörung, Bewahrung, Wiederaufbau» und «Beleuchtet unser ambivalentes Verhältnis zu Ruinen und dem Verschwinden», wie es im Pressetext zur Ausstellung heisst. Und weiter: «Die Baggerschaufeln aus dem Jahr 2013 … nehmen uns mit auf eine Reise in ein Hin und  Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.
Her zwischen Vorgeschichte und Gegenwart». Die «Vorgeschichte» repräsentieren die Mineralien Onyx und Kalkspat, die anstelle des Stahlgestänges, welche die Schaufel mit dem Baggerarm verbindet, eingesetzt sind. Zu sehen sind in Basel, erstmals in Europa, neun grosse und kleine Baumaschinenteile. (Im Gegensatz zu der umfangreicheren Installation vor fünf Jahren in der New Yorker Gladstone Gallery, wo rund ein Dutzend, bedrohlich eng neben und gegen einander platzierte Schaufeln zum Teil mit Goldbronze-Bemalung als Schmuckstücke daherkamen, soll bei der Präsentation im Tinguely-Museum das Zerstörungspotenzial im Vordergrund stehen.) Die beiden weiteren ausgestellten Werke sind Video-Arbeiten. «Koe» von 2015 zeigt einen Schwarm ursprünglich wohl aus Nordindien eingeschleppte Halsbandsittiche. Die grünen Papageienvögel, von denen es in Deutschland angeblich 30’000 geben soll, drehen in dem Film über der Innenstadt von Düsseldorf ihre Runden. Sie sind auch auf Schlafbäumen in einem Park zu beobachten. Beim Betrachten des Streifens darf man sich Gedanken über das Zusammenspiel der eleganten exotischen Eindringlinge über den Luxusläden der Königsallee machen. Ob Gaillard auch darauf hinweisen möchte, dass rund ein Viertel der Einwohner der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen einen ausländischen Pass haben und dass Englisch neben Deutsch zur Verwaltungssprache erhoben wurde, um hochqualifizierten Expats, darunter besonders viele Japaner, das Leben zu erleichtern, ist nicht bekannt. Der zweite Film, «Nightlife» aus demselben Jahr, ist eine 3D-Produktion, die aus mehreren, nächtlichen Szenen besteht. Zu sehen ist zunächst Rodins Skulptur «Le Penseur» vor dem Cleveland Museum of Art gefolgt von Wacholderbäumen in Los Angeles, die nach Angaben der Saalbroschüre einen «halluzinativen Tanz» aufführen und einem eindrücklichen Feuerwerk über dem Berliner Olympiastadion, wo der afro-amerikanische Leichtathlet Jesse (eigentlich James Cleveland = J.C.) Owens bei den Olympischen Spielen 1936 vier Goldmedaillen gewann und von den Organisatoren mit vier Eichen-Setzlingen geehrt wurde. Einer davon wuchs auf dem Gelände der Rhodes High School in Cleveland zu einem stattlichen Baum heran und bildet nun, beleuchtet von einem darüber kreisenden Hubschrauber, das Zentrum der letzten Filmszene. Begleitet wird das dreidimensionale Filmerlebnis durch eine von Gaillard gemixte Tonspur aus Samples eines Songs des Rocksteady-Musikers Alton Elis, dessen Refrain «I was born a loser» Gaillard in «I was born a winner» umpolt. Da auch der wortreiche Text der Saalbroschüre keinen Aufschluss darüber zu geben vermag, weshalb wir Cyprien Gaillard als einen der interessantesten Künstler seiner Generation betrachten sollen, verlassen wir die Ausstellung ratlos und enttäuscht. Wir fragen uns, weshalb von den im Internet zahlreich abgebildeten und kommentierten interessanten übrigen Arbeiten Gaillards im Museum Tinguely nichts zu sehen ist. Oder anders: Wenn es Gründe gibt, welche die Gaillard-Schau zu einem blossen Köder reduzierten, müsste offen darüber informiert werden.

Der junge Picasso in der Fondation Beyeler
01.02.19 16:35
Auf der Suche nach einer eigenen Bildsprache eignete sich Pablo Picasso (1881-1973), systematisch gefördert von seinem Vater, in den 1890er-Jahren das ganze Spektrum der damals gängigen malerischen Fertigkeiten an. Obwohl überaus erfolgreich, verliess der junge Künstler um die Jahrhundertwende die vorgespurte Karriere und begann, sich malerisch eine eigene Welt zu schaffen. Dabei erlebte Picasso seine Entwicklung durchaus krisenhaft. Der Selbstmord seines Freundes Carles Casagemas, den er auf dem Totenbett porträtierte, setzte ihm schwer zu. Und als er sich 1901, bleich und im schwarzen Mantel, vor blauem Hintergrund selbst darstellte, malte er einen jungen Anarchisten, der aussah, als müsse er das ganze Elend der Welt schultern. In Zusammenarbeit mit den Musées d’Orsay et de l’Orangerie sowie dem  Musée Nationale Picasso in Paris zelebriert die Fondation Beyeler in Riehen vom 3. Februar bis zum 26. Mai 2019 die melancholische «blaue» und die auf den definitiven Umzug nach Paris folgende mehr Zuversicht ausstrahlende «rosa» Periode im Werk des jungen Picasso. In seiner chronologisch angelegten Schau zeigt Kurator Raphaël Bouvier in einmaliger Ausführlichkeit 80 grossartige Zeugnisse aus den sechs entscheidenden Schaffensjahren von 1901 bis 1906. Besucherinnen und Besucher können den Wandel vom virtuosen Maler, der sich alle gängigen Stilformen zu eigen machte, zum eigenständigen Künstler nachvollziehen. Besonders eindrücklich ist der Weg im Multimedia-Raum anhand von Selbstporträts zu sehen, die in jenen sechs entscheidenden Jahren entstanden sind – vom feurig-selbstbewussten «Yo Picasso» bis zum skulptural-reduzierten «Autoportrait» vom Herbst 1906, das den Übergang zu dem 1907 entstandenen Werk «Les Demoiselles d’Avignon» ankündigt, das als erstes kubistisches Gemälde gilt. Nicht überraschend präsentiert die Fondation Beyeler vom 13. Januar bis 5. Mai 2019 parallel zum jungen Picasso unter dem Titel «Picasso Panorama» die 30 Werke, die zum Sammlungsbestand gehören. Sie wurden mit Arbeiten ergänzt, welche die Fondation Beyeler als Dauerleihgaben hütet. Um dem Publikum den Zeitgeist der Pariser Bohème nahe zu bringen, wurde das «Café Parisien» eingerichtet (das allerdings nicht mit der von Picasso und seinen Freunden auf dem Montmartre bevorzugt frequentierten Kaschemme «Lapin Agile» zu vergleichen ist.) Jeden Mittwoch verwandelt sich das Lokal im Souterrrain des Museums in ein Variététheater, in dem unterhaltsame und artistische Darbietungen zu sehen sind. (Das ausführliche Programm ist unter der URL https://www.fondationbeyeler.ch/programm/kalender/ abrufbar.)
Musée Nationale Picasso in Paris zelebriert die Fondation Beyeler in Riehen vom 3. Februar bis zum 26. Mai 2019 die melancholische «blaue» und die auf den definitiven Umzug nach Paris folgende mehr Zuversicht ausstrahlende «rosa» Periode im Werk des jungen Picasso. In seiner chronologisch angelegten Schau zeigt Kurator Raphaël Bouvier in einmaliger Ausführlichkeit 80 grossartige Zeugnisse aus den sechs entscheidenden Schaffensjahren von 1901 bis 1906. Besucherinnen und Besucher können den Wandel vom virtuosen Maler, der sich alle gängigen Stilformen zu eigen machte, zum eigenständigen Künstler nachvollziehen. Besonders eindrücklich ist der Weg im Multimedia-Raum anhand von Selbstporträts zu sehen, die in jenen sechs entscheidenden Jahren entstanden sind – vom feurig-selbstbewussten «Yo Picasso» bis zum skulptural-reduzierten «Autoportrait» vom Herbst 1906, das den Übergang zu dem 1907 entstandenen Werk «Les Demoiselles d’Avignon» ankündigt, das als erstes kubistisches Gemälde gilt. Nicht überraschend präsentiert die Fondation Beyeler vom 13. Januar bis 5. Mai 2019 parallel zum jungen Picasso unter dem Titel «Picasso Panorama» die 30 Werke, die zum Sammlungsbestand gehören. Sie wurden mit Arbeiten ergänzt, welche die Fondation Beyeler als Dauerleihgaben hütet. Um dem Publikum den Zeitgeist der Pariser Bohème nahe zu bringen, wurde das «Café Parisien» eingerichtet (das allerdings nicht mit der von Picasso und seinen Freunden auf dem Montmartre bevorzugt frequentierten Kaschemme «Lapin Agile» zu vergleichen ist.) Jeden Mittwoch verwandelt sich das Lokal im Souterrrain des Museums in ein Variététheater, in dem unterhaltsame und artistische Darbietungen zu sehen sind. (Das ausführliche Programm ist unter der URL https://www.fondationbeyeler.ch/programm/kalender/ abrufbar.)
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikationen ist hier zu finden (und nach Ende der Ausstellung im Archiv).
Zur Ausstellung erschienen drei Publikationen.
Hrsg. Raphaël Bouvier (Fondation Beyeler): Picasso – Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 304 Seiten, € 60.00/CHF 68.00. (Der Katalog ist in einer deutschen und einer englischen Ausgabe verfügbar.
Raphaël Bouvier: Picasso. Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 56 Seiten, € 12.00/CHF 9.80. (Der kleine Begleitband ist in einer deutschen und einer französischen Ausgabe erhältlich.)
Tasnim Baghdadi und Iris Brugger (Beyeler Museum AG): Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode - interaktiv. Das Kinderheft führt mit zehn unterhaltsamen Aufgaben und Spielanleitungen durch die Ausstellung. Das ausgezeichnet gelungene Heft ist kostenlos bei der Information im Eingangsbereich erhältlich.
Illustration: Pablo Picasso,Autoportrait, 1901 (Ausschnitt), Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso/2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikationen ist hier zu finden (und nach Ende der Ausstellung im Archiv).
Zur Ausstellung erschienen drei Publikationen.
Hrsg. Raphaël Bouvier (Fondation Beyeler): Picasso – Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 304 Seiten, € 60.00/CHF 68.00. (Der Katalog ist in einer deutschen und einer englischen Ausgabe verfügbar.
Raphaël Bouvier: Picasso. Blaue und Rosa Periode. Riehen/Berlin 2019 (Beyeler Museum AG/Hatje-Cantz Verlag), 56 Seiten, € 12.00/CHF 9.80. (Der kleine Begleitband ist in einer deutschen und einer französischen Ausgabe erhältlich.)
Tasnim Baghdadi und Iris Brugger (Beyeler Museum AG): Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode - interaktiv. Das Kinderheft führt mit zehn unterhaltsamen Aufgaben und Spielanleitungen durch die Ausstellung. Das ausgezeichnet gelungene Heft ist kostenlos bei der Information im Eingangsbereich erhältlich.
Illustration: Pablo Picasso,Autoportrait, 1901 (Ausschnitt), Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso/2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Mathieu Rabeau
Radiophonic Spaces im Muesum Tinguely
24.10.18 16:13
Einmal mehr profiliert sich das Museum Tinguely in Basel als eine besonders experimentierfreudige Institution der Kunstvermittlung. In Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität in Weimar und dem medienwissenschaftlichen Institut der Uni Basel lädt das Museum vom 23. Oktober 2018 bis zum 27. Januar 2019 zur Erkundung der Radiokunst-Geschichte ein. Unter dem Titel «Radiophonic Spaces» gibt es in der Ausstellung nichts zu sehen, dafür umso mehr zu hören. Besucherinnen und Besucher erhalten beim Eingang ein speziell präpariertes Smartphone und Kopfhörer, mit deren Hilfe sie 210 sorgfältig ausgesuchte Programme erleben können. Wer will, kann sich wie eine menschliche Sendersuchnadel auf einem klassischen Radiogerät durch den vom Multimedia-Künstler Cevdet Erek gestalteten Raum bewegen und dabei Ausschnitte von Radiostücken hören. Bei besonderem Interesse ist es möglich, das ganze Werk zu hören und an Bildschirm-Stationen zusätzliche Informationen und Querverweise abzufragen. Es ist unschwer vorauszusagen, dass nur eine Minderheit des Publikums die Fülle von Möglichkeiten nutzen kann. Das aufwändige Vermittlungskonzept, das aus einem dreijährigen, von Prof. Nathalie Singer geleiteten wissenschaftlichen Forschungsprojekt der Weimarer Bauhaus-Universität hervorging, wird viele überfordern. Denn das Fehlen von Bild-Elementen im Ausstellungsraum und der Einsatz technischen Geräts machen das Eintauchen in die Geschichte der Radiokunst zu einem anspruchsvollen Abenteuer. Wer den Mut (und die Zeit) aufbringt, sich darauf einzulassen, wird allerdings reich belohnt.
 Eine grosse Hilfe bietet eine kostenlose Begleitbroschüre mit einer Anleitung zur Benutzung der technischen Gerätschaften und der eindrücklichen Liste aller 210 Archivstücke. Darunter sind Hörspiele und experimentelle Musikstücke sowie beispielhafte historische Tonaufnahmen, die weit über die akademische Radioforschung hinaus ein breites Publikum interessieren können: Da ist zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. mit einem «Aufruf an das Deutsche Volk» zu hören oder Adolf Reichenberg, der seiner Frau 1899 einen Phonographen zum Geschenk machte und ihr die Neuigkeit auf einer von ihm besprochenen Wachswalze gleich selbst mitteilte. Zum Angebot gehören sodann Grammophonplatten-Experimente von Paul Hindemith und John Cage, oder das epochemachende Hörspiel «The War of the Worlds» von Orson Welles, das 1938 den Überfall von Ausserirdischen auf New York so realistisch erlebbar machte, dass in der Stadt Panik ausbrach. Besondere Beachtung verdienen auch die Hörspiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, darunter das Rückkehrer-Drama «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert, das am 13. Februar 1947 vom NWDR gesendet wurde. (Die Hamburger Uraufführung der Bühnenfassung am 21. November desselben Jahres erlebte Borchert nicht mehr. Er starb, 26-jährig, am Tag davor im Claraspital in Basel.) Die Liste der Preziosen liesse sich fast beliebig erweitern…
Eine grosse Hilfe bietet eine kostenlose Begleitbroschüre mit einer Anleitung zur Benutzung der technischen Gerätschaften und der eindrücklichen Liste aller 210 Archivstücke. Darunter sind Hörspiele und experimentelle Musikstücke sowie beispielhafte historische Tonaufnahmen, die weit über die akademische Radioforschung hinaus ein breites Publikum interessieren können: Da ist zum Beispiel Kaiser Wilhelm II. mit einem «Aufruf an das Deutsche Volk» zu hören oder Adolf Reichenberg, der seiner Frau 1899 einen Phonographen zum Geschenk machte und ihr die Neuigkeit auf einer von ihm besprochenen Wachswalze gleich selbst mitteilte. Zum Angebot gehören sodann Grammophonplatten-Experimente von Paul Hindemith und John Cage, oder das epochemachende Hörspiel «The War of the Worlds» von Orson Welles, das 1938 den Überfall von Ausserirdischen auf New York so realistisch erlebbar machte, dass in der Stadt Panik ausbrach. Besondere Beachtung verdienen auch die Hörspiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, darunter das Rückkehrer-Drama «Draussen vor der Tür» von Wolfgang Borchert, das am 13. Februar 1947 vom NWDR gesendet wurde. (Die Hamburger Uraufführung der Bühnenfassung am 21. November desselben Jahres erlebte Borchert nicht mehr. Er starb, 26-jährig, am Tag davor im Claraspital in Basel.) Die Liste der Preziosen liesse sich fast beliebig erweitern…
Das Museum Tinguely und der verantwortliche Kurator Andres Pardey verlassen sich allerdings nicht darauf, dass ein wissenschaftlich oder historisch weniger interessiertes Publikum automatisch in die Ausstellung drängen wird. Deshalb gruppierten sie rund um die Ausstellung 15 begleitende Themenwochen. In der ersten sind zum Beispiel jeden Tag um 11.30 Uhr und um 15 Uhr zwei Spielfilme zum Thema Radio zu sehen, und in der zweiten können Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Amateurfunkern der Station «Notfunk Birs HB9NFB» selbst Radiosignale senden und empfangen. Auf grosses Interesse wird in der neunten Themenwoche auch die Möglichkeit stossen, unter Anleitung einen eigenen Radioapparat zu bauen. Auch viele weitere Angebote setzen auf die aktive Teilnahme des Publikums. Alle Details sind der Website des Museums zu entnehmen.
Nicht überraschend gibt es in der Ausstellung auch ein eigenes Radiostudio. «RadioTinguely» (www.tinguely.ch/radiotinguely) geht jeden Sonntag um 17 Uhr auf Sendung und berichtet live, moderiert vom bekannten Basler Radiojournalisten Roger Ehret, über die Höhepunkte der vergangenen Themenwoche.

Das Museum Tinguely und der verantwortliche Kurator Andres Pardey verlassen sich allerdings nicht darauf, dass ein wissenschaftlich oder historisch weniger interessiertes Publikum automatisch in die Ausstellung drängen wird. Deshalb gruppierten sie rund um die Ausstellung 15 begleitende Themenwochen. In der ersten sind zum Beispiel jeden Tag um 11.30 Uhr und um 15 Uhr zwei Spielfilme zum Thema Radio zu sehen, und in der zweiten können Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Amateurfunkern der Station «Notfunk Birs HB9NFB» selbst Radiosignale senden und empfangen. Auf grosses Interesse wird in der neunten Themenwoche auch die Möglichkeit stossen, unter Anleitung einen eigenen Radioapparat zu bauen. Auch viele weitere Angebote setzen auf die aktive Teilnahme des Publikums. Alle Details sind der Website des Museums zu entnehmen.
Nicht überraschend gibt es in der Ausstellung auch ein eigenes Radiostudio. «RadioTinguely» (www.tinguely.ch/radiotinguely) geht jeden Sonntag um 17 Uhr auf Sendung und berichtet live, moderiert vom bekannten Basler Radiojournalisten Roger Ehret, über die Höhepunkte der vergangenen Themenwoche.
Victor J. Papanek: The Politics of Design
28.09.18 16:04
Er war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Designer und Design-Theoretiker des 20. Jahrhunderts: Victor J. Papanek (1923-1998), geboren in Wien und geschult in England, emigrierte 1939 nach dem Anschluss Österreichs mit seiner verwitweten Mutter in die USA. Seit 1946 amerikanischer Staatsbürger, studierte er – unter anderem bei Franz Lloyd Wright – Architektur und erwarb 1950 sein Bachelor-Diplom an der privaten Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York.  Fünf Jahre später folgte das Master-Diplom am Massachusetts Institute of Technology. Nach der Ausbildung begann Papanek eine klassische Laufbahn als Industriedesigner im Atelier des «Stromlinien-Gurus» (Alison Clarke in ihrem Katalogbeitrag) Raymond Loewy. Doch bald gab es Krach, als Papanek vorschlug, die traditionellen japanischen Sandalen in einer besonders dicken Sohle als Plateau-Schuh zu gestalten, der es besonders kleinen Menschen – wie seiner Mutter, die nur anderthalb Meter gross war – den Alltag in den normierten Wohnungen zu erleichtern. Loewy spottete über den Entwurf für «die Minderheit» – und half so, Papanek zum scharfen Kritiker der Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu machen. Mit Auftritten im Radio und Fernsehen und in zahlreichen Vorträgen verurteilte er den allgegenwärtigen Kommerz und setzte sich für ein politisch bewusstes und dem Schutz der Umwelt verpflichtetes Verständnis der Produktgestaltung ein. Sein Hauptwerk «Design for the Real World – Human Ecology and Social Change» erschien 1971 und wurde in kurzer Zeit zum weltweit meistgelesenen Buch über Design. So einflussreich dieses Werk bis heute geblieben ist, so blass ist die Erinnerung an seinen Autor geworden. Die Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, die erste umfassende Retrospektive überhaupt, soll dies nun ändern. Zusammen mit der «Victor J. Papanek-Foundation» an der Universität für angewandte Kunst in Wien, der Hüterin des Nachlasses, stellen die Kuratorinnen Amelie Klein und Alison J. Clarke vom 29. September 2018 bis zum 10. März 2019 den kritischen Geist unter dem Titel «The Politics of Design» in den Zusammenhang seiner Zeit und zeigen seine Wirkung bis in die Gegenwart, indem sie an 20 zeitgenössischen Werken demonstrieren, wie Papaneks Überzeugungen weiterleben. Die ersten beiden Abteilungen präsentieren anhand einer Medien-Installation und einer eindrücklichen biografischen Übersicht, die Papaneks Leben von der Flucht aus Europa bis zum internationalen Erfolg umfasst, den zeitgeschichtlichen Kontext des bahnbrechenden Werks. Die Fülle der Dokumente in diesem Teil ist überwältigend. Wer hier lieber nicht ins Detail gehen möchte, tut gut daran, das umfangreiche und sehr ansprechend gestaltete Katalogbuch zu konsultieren, in dem zahlreiche Exponate abgebildet und ausführlich erläutert sind. In den weiteren Räumen sind die Hauptthemen von Papaneks Werk dargestellt: seine kritische Haltung zur Wegwerfkultur, sein Engagement für Minderheiten und die so genannte Dritte Welt, sowie für Ökologie und Nachhaltigkeit. Eine Fülle von Entwürfen belegen seine Überzeugung, dass gestalterische Probleme am besten im Kollektiv gelöst werden sollen.
Fünf Jahre später folgte das Master-Diplom am Massachusetts Institute of Technology. Nach der Ausbildung begann Papanek eine klassische Laufbahn als Industriedesigner im Atelier des «Stromlinien-Gurus» (Alison Clarke in ihrem Katalogbeitrag) Raymond Loewy. Doch bald gab es Krach, als Papanek vorschlug, die traditionellen japanischen Sandalen in einer besonders dicken Sohle als Plateau-Schuh zu gestalten, der es besonders kleinen Menschen – wie seiner Mutter, die nur anderthalb Meter gross war – den Alltag in den normierten Wohnungen zu erleichtern. Loewy spottete über den Entwurf für «die Minderheit» – und half so, Papanek zum scharfen Kritiker der Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu machen. Mit Auftritten im Radio und Fernsehen und in zahlreichen Vorträgen verurteilte er den allgegenwärtigen Kommerz und setzte sich für ein politisch bewusstes und dem Schutz der Umwelt verpflichtetes Verständnis der Produktgestaltung ein. Sein Hauptwerk «Design for the Real World – Human Ecology and Social Change» erschien 1971 und wurde in kurzer Zeit zum weltweit meistgelesenen Buch über Design. So einflussreich dieses Werk bis heute geblieben ist, so blass ist die Erinnerung an seinen Autor geworden. Die Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, die erste umfassende Retrospektive überhaupt, soll dies nun ändern. Zusammen mit der «Victor J. Papanek-Foundation» an der Universität für angewandte Kunst in Wien, der Hüterin des Nachlasses, stellen die Kuratorinnen Amelie Klein und Alison J. Clarke vom 29. September 2018 bis zum 10. März 2019 den kritischen Geist unter dem Titel «The Politics of Design» in den Zusammenhang seiner Zeit und zeigen seine Wirkung bis in die Gegenwart, indem sie an 20 zeitgenössischen Werken demonstrieren, wie Papaneks Überzeugungen weiterleben. Die ersten beiden Abteilungen präsentieren anhand einer Medien-Installation und einer eindrücklichen biografischen Übersicht, die Papaneks Leben von der Flucht aus Europa bis zum internationalen Erfolg umfasst, den zeitgeschichtlichen Kontext des bahnbrechenden Werks. Die Fülle der Dokumente in diesem Teil ist überwältigend. Wer hier lieber nicht ins Detail gehen möchte, tut gut daran, das umfangreiche und sehr ansprechend gestaltete Katalogbuch zu konsultieren, in dem zahlreiche Exponate abgebildet und ausführlich erläutert sind. In den weiteren Räumen sind die Hauptthemen von Papaneks Werk dargestellt: seine kritische Haltung zur Wegwerfkultur, sein Engagement für Minderheiten und die so genannte Dritte Welt, sowie für Ökologie und Nachhaltigkeit. Eine Fülle von Entwürfen belegen seine Überzeugung, dass gestalterische Probleme am besten im Kollektiv gelöst werden sollen.
 Zur Ausstellung erschien, wie erwähnt, ein Katalogbuch, das einen umfassenden Einblick in Papaneks Denken ermöglicht. es macht nachvollziehbar, dass sein Ansatz, der seinerzeit revolutionär war, heute allgemein anerkannt ist: Design darf sich nicht auf die blosse Ästhetik von Gegenständen beschränken, sondern muss sich seiner gesellschaftlichen Funktion bewusst sein. Mateo Kries, Amelie Klein, Alison J. Clarke (Hrsg.): Victor Papanek – The Politics of Design. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum). 400 Seiten, €59.90
Zur Ausstellung erschien, wie erwähnt, ein Katalogbuch, das einen umfassenden Einblick in Papaneks Denken ermöglicht. es macht nachvollziehbar, dass sein Ansatz, der seinerzeit revolutionär war, heute allgemein anerkannt ist: Design darf sich nicht auf die blosse Ästhetik von Gegenständen beschränken, sondern muss sich seiner gesellschaftlichen Funktion bewusst sein. Mateo Kries, Amelie Klein, Alison J. Clarke (Hrsg.): Victor Papanek – The Politics of Design. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum). 400 Seiten, €59.90
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs folgen hier.
Illustration: Porträtfoto Victor Papanek ca. 1981 (Scan aus dem Katalog, © 2018 Kansas City Art Institute).


Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs folgen hier.
Illustration: Porträtfoto Victor Papanek ca. 1981 (Scan aus dem Katalog, © 2018 Kansas City Art Institute).
Balthus bei Beyeler
01.09.18 11:54
Vom 2. September 2018 bis 1. Januar 2019 zeigt die Fondation Beyeler in Riehen – zum ersten Mal in der deutschsprachigen Schweiz – eine grosse Retrospektive auf das Werk des deutsch-französischen Künstlers Balthazar Klossowski de Rola, genannt Balthus (1908 bis 2001). Der wegen seiner lasziv inszenierten jungen Mädchen umstrittene Exzentriker wird dem Publikum von Kurator Raphaël Bouvier und Kuratorin Michiko Kono als «Künstler des Widerspruchs» (oder wohl eher der Widersprüchlichkeit) «und der Irritation» vorgestellt. Tatsächlich zeigen die 40 ausgestellten Bilder, die für das Gesamtwerk von lediglich 340 Gemälden als repräsentativ gelten, ein grosses Spektrum von Sujets: Strassenszenen, Landschaftsbilder, Porträts, Interieurs. Im Zentrum steht dabei die grossformatige «Passage du Commerce Saint-André», die 1952 bis 1954 gemalt wurde und als Dauerleihgabe zur Sammlung der Fondation Beyeler gehört. Die rätselhafte, raffiniert gebaute Szene zeigt acht Personen und einen Hund, die – nicht unähnlich einem Video-Still – in ihren Bewegungen eingefroren scheinen. Typisch für Balthus ist die Raffinesse des Bildausschnitts. Scheinbar spontan werden Figuren an- und Füsse abgeschnitten: ein Bild wie eine Lomografie. Balthus war Autodidakt, hoch begabt, wie schon Rainer Maria Rilke feststellte, der den Sohn seiner Geliebten Else Kosslowski nach Kräften förderte. Mit 16, zusammen mit Mutter und Bruder wieder in Paris, begann er auf Anraten des Familienfreundes Pierre Bonnard im Louvre alte Meister zu kopieren, später malte er in der Toskana Bilder von Frührenaissance-Künstlern nach. Dies alles ist, folgt man den Balthus-Experten, im Werk zu sehen. Unbestritten ist, dass die Malerei keinem Stil der Moderne zuzuordnen ist. Balthus malte gegenständlich, wenn seine Freunde, darunter Pablo Picasso, die Möglichkeiten der Abstraktion erprobten oder dem Surrealismus frönten. Nach einer ersten Einzelausstellung 1934, die ein totaler Misserfolg war, gewann er als Porträtist ein gewisses Renommee. Gleichzeitig pflegte er sein Image als Aussenseiter, der sich dank reicher Freundinnen und Freunde einen extravaganten Lebensstil leisten konnte. Die Selbstinszenierung, zu der auch ein erfundener Grafentitel gehörte, seine Bildnisse pubertierender Mädchen und die übrigen, oft rätselhaften Sujets sowie sein handwerkliches Geschick wurden zu seinen Markenzeichen. Wer die Ausstellung in der Fondation Beyeler besucht, erhält die Möglichkeit, sich über die Qualität dieses eigenartigen Œuvres ein Urteil zu bilden und sich die Frage zu stellen, ob es auch jenseits der Provokation weiter Bestand haben wird.
ein grosses Spektrum von Sujets: Strassenszenen, Landschaftsbilder, Porträts, Interieurs. Im Zentrum steht dabei die grossformatige «Passage du Commerce Saint-André», die 1952 bis 1954 gemalt wurde und als Dauerleihgabe zur Sammlung der Fondation Beyeler gehört. Die rätselhafte, raffiniert gebaute Szene zeigt acht Personen und einen Hund, die – nicht unähnlich einem Video-Still – in ihren Bewegungen eingefroren scheinen. Typisch für Balthus ist die Raffinesse des Bildausschnitts. Scheinbar spontan werden Figuren an- und Füsse abgeschnitten: ein Bild wie eine Lomografie. Balthus war Autodidakt, hoch begabt, wie schon Rainer Maria Rilke feststellte, der den Sohn seiner Geliebten Else Kosslowski nach Kräften förderte. Mit 16, zusammen mit Mutter und Bruder wieder in Paris, begann er auf Anraten des Familienfreundes Pierre Bonnard im Louvre alte Meister zu kopieren, später malte er in der Toskana Bilder von Frührenaissance-Künstlern nach. Dies alles ist, folgt man den Balthus-Experten, im Werk zu sehen. Unbestritten ist, dass die Malerei keinem Stil der Moderne zuzuordnen ist. Balthus malte gegenständlich, wenn seine Freunde, darunter Pablo Picasso, die Möglichkeiten der Abstraktion erprobten oder dem Surrealismus frönten. Nach einer ersten Einzelausstellung 1934, die ein totaler Misserfolg war, gewann er als Porträtist ein gewisses Renommee. Gleichzeitig pflegte er sein Image als Aussenseiter, der sich dank reicher Freundinnen und Freunde einen extravaganten Lebensstil leisten konnte. Die Selbstinszenierung, zu der auch ein erfundener Grafentitel gehörte, seine Bildnisse pubertierender Mädchen und die übrigen, oft rätselhaften Sujets sowie sein handwerkliches Geschick wurden zu seinen Markenzeichen. Wer die Ausstellung in der Fondation Beyeler besucht, erhält die Möglichkeit, sich über die Qualität dieses eigenartigen Œuvres ein Urteil zu bilden und sich die Frage zu stellen, ob es auch jenseits der Provokation weiter Bestand haben wird.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid entstanden ist, und des sehr ansprechend gestalteten Katalogs ist hier nachzulesen.
Illustration: Le Roi des chats (Selbstporträt 1935) © Balthus, Foto Etienne Malapert, Musée cantonal des Beaux-Arts des Lausanne

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid entstanden ist, und des sehr ansprechend gestalteten Katalogs ist hier nachzulesen.
Illustration: Le Roi des chats (Selbstporträt 1935) © Balthus, Foto Etienne Malapert, Musée cantonal des Beaux-Arts des Lausanne
Möbelgestalter Dieter Waeckerlin
20.08.18 22:30

Eine ausführliche Besprechung des Buches steht hier zur Verfügung.
Hochschule Luzern, Institut für Innenarchitektur (Hrsg.): Dieter Waeckerlin und Idealheim. Basel 2018 (Christoph Merian Verlag), 212 Seiten, CHF 49.00/€ 48.00.
Das Museum Tinguely präsentiert seine Sammlung neu
27.06.18 07:57


Aus Anlass der neuen Sammlungspräsentation führt das Museum auch den digitalen Ausstellungsguide Meta-Tinguely ein, der anhand der Biografie des Künstlers und von neun ausgewählten Werken durch Jean Tinguelys Œuvre führt und sein künstlerisches Schaffen erläutert. Der ebenso übersichtlich wie unterhaltsam gestaltete Guide kann entweder über die Website oder – in der Ausstellung – über das Gratis-WLAN des Museums aufgerufen werden. Er bietet in Wort, Bild und Ton eine Fülle von Informationen, die entweder mit Hilfe der Suchfunktionen oder als Antworten auf einfache Fragen auf Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen.
Illustrationen: © Jürg Bürgi 2018. Oben: Kinetische Reliefs aus der ersten Schaffensperiode. Unten: Ideen für den Neubau der Wettsteinbrücke in Basel.
Gauri Gill zeigt Geburt und Tod in Rjasthan
12.06.18 14:11


Illustrationen aus der Ausstellung: ©2018, Jürg Bürgi, Basel.
Nur keine Panik! Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger im Museum Tinguely
05.06.18 16:10



Illustrationen: © 2015, Domaine de Chaumont-sur-Loire - Centre d’arts e t de nature (oben),
© 2018 Jürg Bürgi, Basel (Mitte, unten).
Francis Bacon und Alberto Giacometti in der Fondation Beyeler
02.05.18 14:10

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und eine Würdigung der begleitenden Publikation ist hier zu finden.
Zur Ausstellung erschien eine reich illustrierte Publikation in je einer deutschen und englischen Ausgabe.
Grenier, C., Küster, U., Peppiatt M. (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Bacon-Giacometti. Riehen/Berlin 2018 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 204 Seiten, € 58.00/CHF 62.50
Illustration: Umschlag des Ausstellungskatalogs.
Basel Short Stories im Kunstmusem Basel
22.04.18 10:47
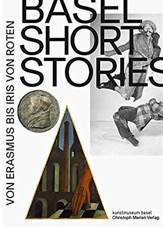
Die ausführliche Besprechung der Ausstellung und der Publikation steht hier als PDF zur Verfügung.
Helfenstein, J., Düblin, K., Wismer, M. (Hg): Basel Short Stories. Von Erasmus bis Iris von Roten. Basel 2018 (Christoph Merian Verlag). 238 Seiten, CHF 38.00
Night Fever im Vitra Design Museum
17.03.18 16:15
Nightclubs als Gesamtkunstwerke – Innenarchitektur, Möbeldesign, Grafik und Kunst, Licht und Musik – waren in vielen Grossstädten seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Zentren der populären Kultur. Hier tobte sich die Kunstszene aus, hier mussten sich Schwule und Lesben nicht verstecken, hier wurden – zum Teil in atemberaubendem Tempo – neue Musikstile kreiert und technisches Equipment lanciert, bevor der Kommerz die kreative Subkultur überrollte und der Niedergang seinen Anfang nahm. Unter dem Titel «Night Fever – Design und Clubkultur 1960 bis heute» zeigt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein vom 17. März bis 9. September 2018 in Zusammenarbeit mit dem Brüsseler Design Museum «ADAM» die erste umfassende Ausstellung zur Design- und Kulturgeschichte der Nachtclubs. Die chronologisch aufgebaute Ausstellung präsentiert sowohl Erinnerungsstücke wie (Plakate, Möbel und Nachtschwärmer Outfits) als auch Filmdokumente Musikbeispiele und technische Einrichtungen von Clubs in Italien, Spanien, Deutschland, Grossbritannien und den USA. Ein Rundgang durch die mit grosser Kennerschaft von Jochen Eisenbrand, Catharine Rossi und Katarina Serulus gestaltete Schau führt von den Anfängen in den 1960er Jahre, als junge  Menschen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bereit und in der Lage waren, um in der Freizeit Geld auszugeben. In Italien und Grossbritannien entstanden – oft als Teil von grossen Einkaufszentren – neuartige Unterhaltungsstätten, wo nicht nur getanzt wurde, sondern auch Konzerte, Theateraufführungen und Performances stattfanden. Zehn Jahre später waren Discos modern, wo Schallplatten mit Musik verschiedener Stilrichtungen gespielt wurden. Die immer bessere technische Ausrüstung ermöglichte neue, die Sinne berauschende Licht- und Toneffekte, und die Disc-Jockeys, die bis dahin nur dafür sorgten, dass keine Lücken im Soundteppich entstanden, entwickelten sich zu eigenständigen Tonkünstlern. Klar, dass sich die Entwicklung in technischer Hinsicht und der Zwang, dem anspruchsvollen Publikum zu gefallen, auch auf die Architektur der Freizeittempel auswirkte. Sie wurden immer grösser, ihre Einrichtungen immer aufwändiger – bis das System kollabierte, weil hohe Mieten und Immobilienpreise in den Cities mit den Einnahmen nicht mehr zu finanzieren waren und das Publikum von Festivals und anderen Grossveranstaltungen absorbiert wurde. Man mag bedauern, dass sich die Ausstellung «Night Fever» ausschliesslich auf die Auswirkungen der Clubszene auf Design und Kultur konzentriert. Die Ausweitung des Fokus auf die historische Einbettung in den Kontext einer besonders aufgewühlten Epoche – Stichworte: Vietnamkonflikt, Drogenkonsum, Studentenbewegung, Kalter Krieg – hätte illustrieren können, dass Diskotheken mehr sein konnten als «ein Organismus hedonistischer Ausschweifung» (so Damon Rich im Essay «Palladian Demise»). Im Begleitbuch zur Ausstellung zeigt Iván López Munuera am berühmten «Palladium» in New York, dass die «Gemeinde der Tanzenden … mit ihrem Treiben eine bestimmte Art des politischen Engagements» verkörperten. In der Anfangszeit waren Männer-Tanzlokale illegal; mindestens jeder vierte Gast in einem New Yorker Nightclub musste weiblich sein. Die Tanzfläche, schreibt Munuera, sei damals ein umkämpftes Territorium gewesen, das überwiegend von sexuellen Minderheiten in Beschlag genommen wurde. Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Frauen rangen um ihre Emanzipation, die ihnen in der Nixon-Ära und später unter Reagan «demokratische Repräsentanz» sichern half. «Als Folge dieses Prozesses bildete sich eine Art kollektiver Intelligenz heraus, die …ihre grösste Wirkung entfaltete, als es ab Mitte der achtziger Jahre darum ging, gemeinsam auf die Krise von HIV und Aids zu reagieren.»
Menschen erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bereit und in der Lage waren, um in der Freizeit Geld auszugeben. In Italien und Grossbritannien entstanden – oft als Teil von grossen Einkaufszentren – neuartige Unterhaltungsstätten, wo nicht nur getanzt wurde, sondern auch Konzerte, Theateraufführungen und Performances stattfanden. Zehn Jahre später waren Discos modern, wo Schallplatten mit Musik verschiedener Stilrichtungen gespielt wurden. Die immer bessere technische Ausrüstung ermöglichte neue, die Sinne berauschende Licht- und Toneffekte, und die Disc-Jockeys, die bis dahin nur dafür sorgten, dass keine Lücken im Soundteppich entstanden, entwickelten sich zu eigenständigen Tonkünstlern. Klar, dass sich die Entwicklung in technischer Hinsicht und der Zwang, dem anspruchsvollen Publikum zu gefallen, auch auf die Architektur der Freizeittempel auswirkte. Sie wurden immer grösser, ihre Einrichtungen immer aufwändiger – bis das System kollabierte, weil hohe Mieten und Immobilienpreise in den Cities mit den Einnahmen nicht mehr zu finanzieren waren und das Publikum von Festivals und anderen Grossveranstaltungen absorbiert wurde. Man mag bedauern, dass sich die Ausstellung «Night Fever» ausschliesslich auf die Auswirkungen der Clubszene auf Design und Kultur konzentriert. Die Ausweitung des Fokus auf die historische Einbettung in den Kontext einer besonders aufgewühlten Epoche – Stichworte: Vietnamkonflikt, Drogenkonsum, Studentenbewegung, Kalter Krieg – hätte illustrieren können, dass Diskotheken mehr sein konnten als «ein Organismus hedonistischer Ausschweifung» (so Damon Rich im Essay «Palladian Demise»). Im Begleitbuch zur Ausstellung zeigt Iván López Munuera am berühmten «Palladium» in New York, dass die «Gemeinde der Tanzenden … mit ihrem Treiben eine bestimmte Art des politischen Engagements» verkörperten. In der Anfangszeit waren Männer-Tanzlokale illegal; mindestens jeder vierte Gast in einem New Yorker Nightclub musste weiblich sein. Die Tanzfläche, schreibt Munuera, sei damals ein umkämpftes Territorium gewesen, das überwiegend von sexuellen Minderheiten in Beschlag genommen wurde. Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Frauen rangen um ihre Emanzipation, die ihnen in der Nixon-Ära und später unter Reagan «demokratische Repräsentanz» sichern half. «Als Folge dieses Prozesses bildete sich eine Art kollektiver Intelligenz heraus, die …ihre grösste Wirkung entfaltete, als es ab Mitte der achtziger Jahre darum ging, gemeinsam auf die Krise von HIV und Aids zu reagieren.»
Der Katalog der Ausstellung, der in einer deutschen und einer englischen Ausgabe erschien, ist eine sehr schön gestaltete, ebenso facettenreiche wie tiefgründige Materialsammlung mit einer Reihe von aufschlussreichen Aufsätzen und Interview-Texten.
Kries, M., Eisenbrand, J., Rossi, C. (Hrsg.): Night Fever. Design und Clubkultur 1960-heute. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum), 400 Seiten, €59.90.
Illustration: © Jürg Bürgi, Basel (2018), Installationsansicht aus der Ausstellung (DJ Larry Levan, Paradise Garage, New York, 1979 mit Grafik von Keith Haring.)

Der Katalog der Ausstellung, der in einer deutschen und einer englischen Ausgabe erschien, ist eine sehr schön gestaltete, ebenso facettenreiche wie tiefgründige Materialsammlung mit einer Reihe von aufschlussreichen Aufsätzen und Interview-Texten.
Kries, M., Eisenbrand, J., Rossi, C. (Hrsg.): Night Fever. Design und Clubkultur 1960-heute. Weil am Rhein 2018 (Vitra Design Museum), 400 Seiten, €59.90.
Illustration: © Jürg Bürgi, Basel (2018), Installationsansicht aus der Ausstellung (DJ Larry Levan, Paradise Garage, New York, 1979 mit Grafik von Keith Haring.)
Bruce Nauman im Schlaulager der Laurenz-Stiftung
16.03.18 15:03
Über 170 Arbeiten auf über 4000 Quadratmetern: Eine so umfassende Retrospektive auf das in über 50 Künstlerjahren entstandene Werk von Bruce Nauman (*1941) gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. In Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art in New York bietet die Laurenz-Stiftung in ihrem Schaulager in Münchenstein bei Basel vom 17. März bis zum 26. August 2018 einen einzigartigen Einblick in das kreative Universum eines der wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Auf dem Parcours durch die von Kathy Halbreich (Laurenz Foundation und MoMA) mit Heidi Naef und Isabel Friedli (Schaulager) kuratierte Schau sind unter dem Titel «Disappearing Acts» sowohl ganz frühe als auch neueste Werke zu entdecken, darunter – als Weltpremieren – die 3D-Video-Installation «Contraposto Split» (2017) und die vor kurzem fertiggestellte Skulptur «Leaping Foxes» (2018), eine kopfstehende Variante der «Animal Pyramide» von 1989. Selbstverständlich sind auch die seit Jahren als Ikonen der Gegenwartskunst geltenden  Neonröhren-Installationen prominent präsent. Unübersehbar ist die Fülle der Medien und Materialien, die Nauman für seine Werke verwendet. In der Vorbereitungsphase arbeitet er seit jeher ganz traditionell mit Entwurfszeichnungen auf Papier, bevor er seine Ideen umsetzt und dabei neben vergänglichem und dauerhaftem Material für Skulpturen und Environments in grossem Massstab auch Fotos, Video, Film und Neonröhren verwendet. Typisch für Nauman ist, dass seinen Arbeit kein einheitliches stilistisches oder konzeptuelles Prinzip zugrunde liegt – was ihm gelegentlich auch zum Vorwurf gemacht wurde. Kuratorin Kathy Halbreich fand in den «verschiedenen Erscheinungsweisen des Verschwindens» ein Muster in Naumans Gesamtwerk, das sie nun ihrem Ausstellungskonzept zugrunde legte.«Disappearing Acts», schreibt sie, «weckten und fesselten seine emotionale, intellektuelle und formale Aufmerksamkeit von seinen letzten Studienjahren bis heute». Uns fiel auf unserem ersten Rundgang auf, wie oft der Künstler ausweglose Situationen darstellt: Die beklemmende Enge der «Corridor-Installation», die 100 Varianten des «Live and Die»-Neon-Tableaus, die Endlosschleife der Neon-Installation «The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths», die Folter von Clowns in Videos, oder das von Todesfurcht geprägten Finale des gefilmten Zwiegesprächs «Good Boy Bad Boy»: «I don’t want to die. You don’t want to die. We don’t want to die. This is fear of death.» Auf ähnliche Beklemmung zielen die bewegten Neon-Skulpturen aus, die Sex mit Mord und Selbstmord verbinden. Und viele andere.
Neonröhren-Installationen prominent präsent. Unübersehbar ist die Fülle der Medien und Materialien, die Nauman für seine Werke verwendet. In der Vorbereitungsphase arbeitet er seit jeher ganz traditionell mit Entwurfszeichnungen auf Papier, bevor er seine Ideen umsetzt und dabei neben vergänglichem und dauerhaftem Material für Skulpturen und Environments in grossem Massstab auch Fotos, Video, Film und Neonröhren verwendet. Typisch für Nauman ist, dass seinen Arbeit kein einheitliches stilistisches oder konzeptuelles Prinzip zugrunde liegt – was ihm gelegentlich auch zum Vorwurf gemacht wurde. Kuratorin Kathy Halbreich fand in den «verschiedenen Erscheinungsweisen des Verschwindens» ein Muster in Naumans Gesamtwerk, das sie nun ihrem Ausstellungskonzept zugrunde legte.«Disappearing Acts», schreibt sie, «weckten und fesselten seine emotionale, intellektuelle und formale Aufmerksamkeit von seinen letzten Studienjahren bis heute». Uns fiel auf unserem ersten Rundgang auf, wie oft der Künstler ausweglose Situationen darstellt: Die beklemmende Enge der «Corridor-Installation», die 100 Varianten des «Live and Die»-Neon-Tableaus, die Endlosschleife der Neon-Installation «The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths», die Folter von Clowns in Videos, oder das von Todesfurcht geprägten Finale des gefilmten Zwiegesprächs «Good Boy Bad Boy»: «I don’t want to die. You don’t want to die. We don’t want to die. This is fear of death.» Auf ähnliche Beklemmung zielen die bewegten Neon-Skulpturen aus, die Sex mit Mord und Selbstmord verbinden. Und viele andere.
Weil im Schaulager der Platz für drei weitere, besonders raumgreifende Arbeiten fehlte, sind diese im Kunstmuseum Basel ausgestellt. Das Ausstellungsticket, das zum dreimaligen Eintritt ins Schaulager berechtigt, gilt auch für einen einmaligen Besuch des Kunstmuseums.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, auch unter Berücksichtigung der Publikationen, folgt demnächst hier.
Der Bedeutung der Retrospektive entsprechend befassen sich mehrere neue Publikationen mit Bruce Naumans Werk.
Der Katalog enthält weit mehr als die ausgestellten Werke und Erläuterungen dazu, er bietet vielmehr ein Inventar des ganzen Œuvres und versammelt Aufsätze der bedeutendsten Fachleute über zahlreiche Aspekte von Naumans Kunst-Kosmos. Halbreich, K. et al. (Hrsg.): Bruce Nauman: Disappearing Acts. Münchenstein/New York 2018 (Laurenz-Stiftung/Museum of Modern Art). 356 Seiten, CHF 75.00.
Eine weitere Publikation befasst sich aus kunstwissenschaftlicher Sicht mit der Zeitgenossenschaft von Naumans Werk. Ehninger, E. (Hrsg. für die Laurenz-Stiftung): Bruce Nauman: A Contemporary. Münchenstein 2018 (Laurenz-Stiftung). 262 Seiten, CHF 28.00
Für Besucherinnen und -besucher steht ein sorgfältig gestaltetes Ausstellungsheft zur Verfügung, in dem der Künstler und seine Werke kenntnisreich vorgestellt werden.
Illustration: Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967, Ausstellungskopie, © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zürich, Foto: Tom Bisig, Basel (Ausschnitt der Ausstellungsansicht).

Weil im Schaulager der Platz für drei weitere, besonders raumgreifende Arbeiten fehlte, sind diese im Kunstmuseum Basel ausgestellt. Das Ausstellungsticket, das zum dreimaligen Eintritt ins Schaulager berechtigt, gilt auch für einen einmaligen Besuch des Kunstmuseums.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung, auch unter Berücksichtigung der Publikationen, folgt demnächst hier.
Der Bedeutung der Retrospektive entsprechend befassen sich mehrere neue Publikationen mit Bruce Naumans Werk.
Der Katalog enthält weit mehr als die ausgestellten Werke und Erläuterungen dazu, er bietet vielmehr ein Inventar des ganzen Œuvres und versammelt Aufsätze der bedeutendsten Fachleute über zahlreiche Aspekte von Naumans Kunst-Kosmos. Halbreich, K. et al. (Hrsg.): Bruce Nauman: Disappearing Acts. Münchenstein/New York 2018 (Laurenz-Stiftung/Museum of Modern Art). 356 Seiten, CHF 75.00.
Eine weitere Publikation befasst sich aus kunstwissenschaftlicher Sicht mit der Zeitgenossenschaft von Naumans Werk. Ehninger, E. (Hrsg. für die Laurenz-Stiftung): Bruce Nauman: A Contemporary. Münchenstein 2018 (Laurenz-Stiftung). 262 Seiten, CHF 28.00
Für Besucherinnen und -besucher steht ein sorgfältig gestaltetes Ausstellungsheft zur Verfügung, in dem der Künstler und seine Werke kenntnisreich vorgestellt werden.
Illustration: Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967, Ausstellungskopie, © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zürich, Foto: Tom Bisig, Basel (Ausschnitt der Ausstellungsansicht).
RE-SET: Die Paul Sacher Stiftung im Museum Tinguely
28.02.18 11:12
Das Museum Tinguely spricht in seinen Texten zur Ausstellung «RE-SET – Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst seit 1900», die es vom 28. Februar bis 13. Mai 2018 präsentiert, von einer «Zusammenarbeit». In Wirklichkeit gewährt das Museum Tinguely der «Paul-Sacher-Stiftung» Gastrecht für eine grosse Ausstellung, während im Erdgeschoss ein bedauernswert kurzer, von Annja Müller-Alsbach kuratierter «kunsthistorischer Prolog» zu sehen ist, der auf die Wirkung von Marcel Duchamps ikonischen Werken auf das Kunstschaffen von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart fokussiert.
Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.
Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».
 Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.
Mauricio Kagel ist zwar im Durchgang zum Treppenhaus ein kurzer Auftritt mit seiner witzigen Hommage zu Ludwig van Beethovens 200. Geburtstag, dem WDR-Film «Ludwig van» von 1970 vergönnt – aber wer mag schon 90 Minuten stehend vor einem kleinen Bildschirm verbringen? Zudem: Dass das Werk in Zusammenarbeit mit Kagels Künstlerfreunden Joseph Beuys, Ursula Burghardt, Robert Filiou Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, Dieter Roth, Otto Tomek und Stefan Wewerka entstand, hätte mannigfaltige Möglichkeiten geboten, das Zusammenspiel unter Kunstschaffenden zu illustrieren.
 Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.
Die Kuratorin Heidy Zimmermann und der Kurator Simon Olbert inszenieren ihr Thema in vier Kapiteln. Im ersten Raum zeigen sie Komponisten – unter dem Titel «Eigentümlich fremd» – im Dialog mit historischen Vorbildern, darunter der mittelalterliche Musiker Guillaume de Machaut (gest. 1377), aber auch Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder, aus neuerer Zeit, Erik Satie (1866-1925). Sie alle lieferten Material für Bearbeitungen. Besucherinnen und Besucher steht beim Eingang ein Tablet-Computer mit einem speziellen Programm zur Verfügung, das die ausgestellten Notenblätter zum Klingen bringt.
Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.
Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.
seinen epochemachenden Film «2001: Odyssee im Weltraum» einbaute.
Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.
Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.
Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).
Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.
Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.
Sosehr man das Ungleichgewicht bedauern mag: Sehr sehenswert sind die ungleichen Teile der Ausstellung allemal.
Im zweiten Obergeschoss dokumentiert die Sacher-Stiftung, losgelöst von jedem Bezug zur bildenden Kunst, ihre weltweit einzigartige Rolle bei der Erforschung der Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Schade, dass die Ausstellung ganz davon absieht, Brücken zwischen den kreativen Welten zu bauen, obwohl sowohl zum Beispiel Igor Strawinsky als auch Arnold Schönberg, die in der Stiftung prominent vertreten sind, enge Beziehungen zur bildenden Kunst pflegten: Strawinsky verglich sein Komponieren mit dem Malen von Bildern; er liess sich von Gemälden inspirieren und sass dutzendfach seinen Künstlerfreunden Modell. Und der doppelt begabte Schönberg gehörte in München zum Kreis des «Blauen Reiter».


Im zweiten Raum wird gezeigt, wie Komponisten ihr eigenen Einfälle variierten und weiter entwickelten. Igor Strawinsky war einer der fleissigsten Selbstbearbeiter, wie am Beispiel des Balletts «Der Feuervogel» gezeigt wird, das er mehrfach bearbeitete, um es konzerttauglich zu machen. Das dritte Kapitel befasst sich mit «Anbindungen an die Volksmusik». Es zeigt, wie Komponisten Reisen unternahmen, um die musikalische Volkskultur festzuhalten – wie das zum Beispiel mit wissenschaftlichem Eifer der Ungar Béla Bartok (1881-1945) in Südosteuropa oder der amerikanische Musiker Steve Reich (*1936) im westafrikanischen Ghana betrieb. Beide liessen sich in ihrem Werk durch ihre Erfahrungen nachhaltig inspirieren.
Erstaunlich ist die im vierten Teil der Ausstellung illustrierte Erkenntnis, dass sich Komponisten des 20. Jahrhunderts weniger oft vom Jazz und anderer populärer Musik ihrer Zeit beeinflussen liessen als von älteren Werken der Musikgeschichte oder von der Folklore. Aber es gibt Ausnahmen! In der Ausstellung ist zu sehen und zu hören, wie Dmitri Schostakowitsch ein Orchester den Schlager «Tea for Two» spielen lässt. Auch die Filmindustrie griff – unter Mithilfe der Komponisten – gern auf Konzertstücke zurück. Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre du printemps» von 1913 gehört zum Soundtrack des Disney-Films «Fantasia» aus dem Jahr 1940, und György Ligetis (1923-2006) Stück «Atmosphère» von 1961 wurde ausserhalb der Avantgarde-Konzertsäle weltberühmt, als Stanley Kubrick es 1968 in

Der Reichtum des musikalischen Teils der Ausstellung RE-SET könnte dem Eindruck Vorschub leisten, der eingangs erwähnte, in drei Räumen konzentrierte «kunsthistorische Prolog» sei bloss als Teaser, laut Wörterbuch ein «Neugier weckendes Werbeelement», für den musikalischen Teil zu verstehen. Ganz falsch! Die Konzentration auf Duchamps ikonische Werke – das Pissbecken «Fountain» von 1917 und der «Flaschentrockner» von 1914 – bringt das Thema der Ausstellung auf einzigartige Weise auf den Punkt. Im ersten Raum dominieren die Wiedergänger der «Fountain», die rund um Duchamps in mehreren Serien gestaltetes Multiple «Boîte-en-valise», ein Mini-Museum in einem Karton-Koffer, versammelt sind. Im zweiten Raum sind teils schwarz-weisse, teils kolorierte Postkarten aus dem Jahr 1917 zu entdecken, die der französische Künstler Saâdane Atif (*1970) gesammelt hat. Alle zeigen ausschliesslich Brunnen im öffentlichen Raum.
Auf ähnlich intensive Art befasst sich die walisische Künstlerin Bethan Huws (*1961) in ihrem Werk mit Marcel Duchamp. Im dritten und grössten Raum des «Prologs» dokumentiert sie ihre Recherchen zu dem bis heute einflussreichen Ahnherrn der Konzeptkunst. Und daneben ist ihr «Forest» von 2008-2009 aufgebaut, ein Wald von Flaschengestellen, über denen die Leuchtschrift «At the Base of the Brain There is a Fountain» signalisiert, was sowohl für die Bildende Kunst als auch für das Musikschaffen gilt: Am Grund des menschlichen Bewusstsein sprudelt eine Quelle der Kreativität.
Zur Ausstellung erschien ein reich illustriertes Katalogbuch. Obert, S. und Zimmermann, H. (Hg.): RE-SET. Rückgriffe und Fortschreibungen in der Musik seit 1900. Eine Publikation der Paul Sacher Stiftung. Mainz 2018 (Schott Music). 328 Seiten, CHF 35.00 (Vorzugspreis während der Ausstellung).
Die Besprechung mit Illustrationen steht hier auch im PDF-Format zur Verfügung.
Illustrationen: Oben: Still aus dem Fernsehfilm von Mauricio Kagel "Ludwig van" (WDR, 1970); Mitte: Béla Bartok transkribiert Volksmelodien (1910er Jahre) © 2018 Bartok Archivum, Budapest; unten: Bethan Huws in ihrem «Forest». © 2018 Jürg Bürgi, Basel.
Gottfried Honegger: Selbstbiografie in Gesprächen
04.02.18 14:30

Christen, Ruedi: Gottfried Honegger. Eine Biographie in Gesprächen. Zürich 2017 (Limmat Verlag). 240 Seiten, CHF 42.00.
Hier geht es ausführlichen Besprechung des Buches.
Sofia Hultén im Museum Tinguely
23.01.18 14:34

Die faszinierende Ausstellung im Museum Tinguely erfordert Geduld beim Schauen und, wenn möglich, sachkundige Erläuterungen, wie sie im sorgfältig gestalteten und reich illustrierten Katalog zu finden sind oder von versierten Sachverständigen bei Führungen vermittelt werden.
Zu den Ausstellungen in Birmingham und Basel erschien ein gemeinsamer Katalog in deutscher und englischer Sprache: Ahlers, L. A. und Watkins, J. (Hg.): Sofia Hultén – Here’s the Answer. What’s the Question?, Birmingham/Basel 2017, 128 Seiten, CHF 28.00
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung .
Illustration: Sofia Hultén. © Jürg Bürgi 2018
Paul Klee – Die abstrakte Dimension in der Fondation Beyeler
29.09.17 17:08
Wer bisher glaubte, das riesige, oft ausgestellte Werk des Malers und Kunstlehrers Paul Klee (1879-1940) biete keine Überraschungen mehr, darf sich vom 1. Oktober 2017 bis 21. Januar 2017 in der Fondation Beyeler in Riehen eines Besseren belehren lassen. Anhand von 110 Bildern aus allen Schaffensperioden demonstriert Kuratorin Anna Szech unter dem Titel «Paul Klee - Die abstrakte Dimension» die lebenslange Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Gegensatz von Gegenständlichkeit und Abstraktion. Während sich viele seiner Zeitgenossen – Kasimir Malewitsch (1878-1935) und Wassily Kandinsky (1866-1944) reklamierten zum Beispiel beide die Erfindung für sich – verbissen stritten, hielt sich Paul Klee abseits und bewegte sich leicht und spielerisch auf dem polemisch verminten Gelände. Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass Klees Fähigkeit, auch in abstrakten Gemälden in Farben und Formen Hinweise auf Gegenständliches zu geben und sie so lesbar zu machen, zu seinem Erfolg beitrug.  Die Ausstellung, welche sich über sieben Säle erstreckt, zeigt in chronologischer Folge und nach thematischen Werkgruppen geordnet, Klees Arbeit im Spannungsfeld von figurativer und abstrakter Malerei beginnt in München, wo er 1910 schnell Anschluss an die Künstlerszene fand, in der Franz Marc und Wassily Kandinsky den Ton angaben. Der junge Klee liess sich allerdings nicht vereinnahmen. Er kennt auch die Pariser Avantgarde und war von Paul Cézanne ebenso beeindruckt wie von Paul Matisse und Pablo Picasso. Und besonders faszinierten ihn die Farbfeld-Bilder von Robert Delaunay. Für sein späteres Werk von elementarer Bedeutung erweist sich die Reise nach Tunesien, die er 1914 vor dem Kriegsausbruch mit den Freunden August Macke (1887-1914) aus München und Louis Moilliet (1880-1962) aus Bern unternahm. Es ist faszinierend in der Ausstellung zu verfolgen, wie sich der junge Klee zuerst den Formen und dann den Farben zuwendet. Auf der Tunesienreise notiert er euphorisch im Tagebuch: «Die Farbe hat mich. … Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler.» Der Erste Weltkrieg – die Freunde Macke und Marc fallen 1914, bzw. 1916 – macht dem Überschwang ein Ende. «Je schreckensvoller diese Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die Kunst», bemerkt er in dieser Zeit, und fährt fort, «während eine glückliche Welt, eine diesseitige Kunst hervorbringt.» Ein faszinierender Gedanke, dass die Abstraktion dem Jenseitigen, will wohl sagen: der Seelenwelt zuzuordnen ist, während das Bodenständige einer heilen Welt vorbehalten ist. Dürfen wir annehmen, dass sich der in Bern aufgewachsene Paul Klee, der 1916 als Deutscher eingezogen wurde, aber vom Frontdienst verschont blieb, gegen die Schrecken wehrte, indem er während der Kriegsjahre gegenständlich malte: Auf den ausgestellten Werken sind Gärten, Häuser, Kirchen gut erkennbar. Der grösste Raum ist dem Jahrzehnt 1921 bis 1931 gewidmet, in dem Klee nicht nur malte, sondern Staatlichen Bauhaus in Weimar und später in Dessau als Meister lehrte. Auch während dieser sehr intensiven und fruchtbaren Schaffensperiode sind Gegenständliches und Abstraktes immer neben einander als «reichblühender farbiger Vielklang» präsent. Am Ende der zwanziger Jahre und zu Beginn der dreissiger Jahre werden Reisen nach Ägypten und Italien in ähnlicher Weise wie der Aufenthalt in Tunesien zu wichtigen Inspirationsquellen. Sehr eindrücklich sind die pointillistischen Mosaikbilder, die nur sehr selten als Serie gezeigt werden können. Den Schluss der überaus eindrücklichen Schau, die von der Begeisterung und der Expertise der Kuratorin durchdrungen ist, bilden Werke aus der Spätzeit, in der – gleichsam im Schlussspurt – über 2000 Bilder entstanden, die von Zeichen und Buchstaben geprägt sind, in denen aber immer wieder auch menschliche Gesichter und Gestalten erkennbar sind.
Die Ausstellung, welche sich über sieben Säle erstreckt, zeigt in chronologischer Folge und nach thematischen Werkgruppen geordnet, Klees Arbeit im Spannungsfeld von figurativer und abstrakter Malerei beginnt in München, wo er 1910 schnell Anschluss an die Künstlerszene fand, in der Franz Marc und Wassily Kandinsky den Ton angaben. Der junge Klee liess sich allerdings nicht vereinnahmen. Er kennt auch die Pariser Avantgarde und war von Paul Cézanne ebenso beeindruckt wie von Paul Matisse und Pablo Picasso. Und besonders faszinierten ihn die Farbfeld-Bilder von Robert Delaunay. Für sein späteres Werk von elementarer Bedeutung erweist sich die Reise nach Tunesien, die er 1914 vor dem Kriegsausbruch mit den Freunden August Macke (1887-1914) aus München und Louis Moilliet (1880-1962) aus Bern unternahm. Es ist faszinierend in der Ausstellung zu verfolgen, wie sich der junge Klee zuerst den Formen und dann den Farben zuwendet. Auf der Tunesienreise notiert er euphorisch im Tagebuch: «Die Farbe hat mich. … Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler.» Der Erste Weltkrieg – die Freunde Macke und Marc fallen 1914, bzw. 1916 – macht dem Überschwang ein Ende. «Je schreckensvoller diese Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die Kunst», bemerkt er in dieser Zeit, und fährt fort, «während eine glückliche Welt, eine diesseitige Kunst hervorbringt.» Ein faszinierender Gedanke, dass die Abstraktion dem Jenseitigen, will wohl sagen: der Seelenwelt zuzuordnen ist, während das Bodenständige einer heilen Welt vorbehalten ist. Dürfen wir annehmen, dass sich der in Bern aufgewachsene Paul Klee, der 1916 als Deutscher eingezogen wurde, aber vom Frontdienst verschont blieb, gegen die Schrecken wehrte, indem er während der Kriegsjahre gegenständlich malte: Auf den ausgestellten Werken sind Gärten, Häuser, Kirchen gut erkennbar. Der grösste Raum ist dem Jahrzehnt 1921 bis 1931 gewidmet, in dem Klee nicht nur malte, sondern Staatlichen Bauhaus in Weimar und später in Dessau als Meister lehrte. Auch während dieser sehr intensiven und fruchtbaren Schaffensperiode sind Gegenständliches und Abstraktes immer neben einander als «reichblühender farbiger Vielklang» präsent. Am Ende der zwanziger Jahre und zu Beginn der dreissiger Jahre werden Reisen nach Ägypten und Italien in ähnlicher Weise wie der Aufenthalt in Tunesien zu wichtigen Inspirationsquellen. Sehr eindrücklich sind die pointillistischen Mosaikbilder, die nur sehr selten als Serie gezeigt werden können. Den Schluss der überaus eindrücklichen Schau, die von der Begeisterung und der Expertise der Kuratorin durchdrungen ist, bilden Werke aus der Spätzeit, in der – gleichsam im Schlussspurt – über 2000 Bilder entstanden, die von Zeichen und Buchstaben geprägt sind, in denen aber immer wieder auch menschliche Gesichter und Gestalten erkennbar sind.
Illustration: Paul Klee (Ausschnitt), fotografiert von Felix Klee, 1921 in Possenhofen. © Klee-Nachlassverwaltung, Bern
Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe eine Publikation mit Beiträgen von Anna Szech, Teodor Currentzis, Fabienne Eggelhöfer, Jenny Holzer, Regine Prange und Peter Zumthor.
Szech, Anna (Hrsg.): Paul Klee – Die abstrakte Dimension. Riehen/Berlin 2017 (Fondation Beyeler/Hatje-Cantz Verlag). 236 Seiten, CHF/EUR 62.50.

Illustration: Paul Klee (Ausschnitt), fotografiert von Felix Klee, 1921 in Possenhofen. © Klee-Nachlassverwaltung, Bern
Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe eine Publikation mit Beiträgen von Anna Szech, Teodor Currentzis, Fabienne Eggelhöfer, Jenny Holzer, Regine Prange und Peter Zumthor.
Szech, Anna (Hrsg.): Paul Klee – Die abstrakte Dimension. Riehen/Berlin 2017 (Fondation Beyeler/Hatje-Cantz Verlag). 236 Seiten, CHF/EUR 62.50.
«An Eames Celebration» im Vitra Design Museum
28.09.17 16:33
Mit einer alle Facetten des Werks umfassenden Präsentation feiert das Vitra Design Museum in Weil am Rhein vom 30. September 2017 bis zum 25. Februar 2018 das einflussreichste Architekten- und Designerpaar des 20. Jahrhunderts – Charles (1907-1978) und Ray (1912-1988) Eames. Die «Eames Celebration» besteht aus vier Ausstellungen: Der Hauptteil vermittelt im Vitra Design Museum unter dem Titel «The Power of Design» einen Überblick über das lebenslange gemeinsame Schaffen des Ehepaars Eames. Die Schau, ursprünglich für das Barbican Centre, London, konzipiert und nun von Kuratorin Jolanthe Kugler ergänzt und neu arrangiert, gibt Einblick in die Entstehung ihrer Möbel; sie zeigt, wie langwierig die Entwurfsprozesse verliefen und mit welcher Sorgfalt das Team im Eames Office arbeitete. Dargestellt wird die ganze Bandbreite des Werks von Charles und Ray Eames, die auch als Ausstellungsarchitekten, Fotografen und Filmschaffende wirkten. Zu sehen sind Entwürfe, Modelle, Zeichnungen, Skulpturen, Filminstallationen und Diaschauen. Gleich nebenan, in der Vitra Design Museum Gallery, ist unter dem Titel «Play Parade» eine Eames-Ausstellung für Kinder aufgebaut. Von Ray und Charles Eames entworfene Spielzeuge sind hier nicht nur zu besichtigen, sie sollen auch ausprobiert werden. In dem bunt inszenierten Raum gibt es zudem Nischen, in denen Kurzfilme zu sehen sind, mit denen das Ehepaar Eames, die auf ausgedehnten Reisen gesammelte Spielsachen lebendig machte. Das Vitra-Museum verfügt über eine einzigartige Sammlung von Möbel-Modellen und -Entwürfen, die das ständige Experimentieren von Charles und Ray Eames dokumentieren. Unter dem Titel «Kazam! Die Möbelexperimente von Charles und Ray Eames» werden diese Preziosen nun im Schaudepot zugänglich gemacht. Und schliesslich die Filme! Nicht weniger als 100 Kurzfilme produzierten Charles und Ray Eames im Lauf der Jahre. Dazu kamen Multimedia-Installationen (als es diesen Begriff noch gar nicht gab) und Ausstellungen über Wissenschaft und Technik. Nicht weniger als 60 dieser Filme sind nun im Rahmen des Eames-Festivals im Feuerwehrhaus zu sehen. Wer alle anschauen will, muss sich allerdings Zeit nehmen: Nicht weniger als acht Stunden und zehn Minuten, rechnet Kuratorin Jolanthe Kugler vor, dauert das ganze Programm. Auch die übrigen Teile des Ausstellungs-Parcours sind es übrigens wert, ohne Eile betrachtet zu werden.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogbuchs gibt es hier.
Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Version die Publikation: Kries, M., Kugler, J. (Hrsg.): Eames Furniture Source Book. Weil am Rhein 2017 (Vitra Design Museum). 336 Seiten, €49.90
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogbuchs gibt es hier.
Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Version die Publikation: Kries, M., Kugler, J. (Hrsg.): Eames Furniture Source Book. Weil am Rhein 2017 (Vitra Design Museum). 336 Seiten, €49.90
Schweizer Performancekunst von 1960 bis heute
19.09.17 16:17
Unter dem Titel «PerformanceProcess» präsentiert das Museum Tinguely in Basel vom 19. September 2017 bis zum 28. Januar 2018 einen Überblick über «60 Jahre Performancekunst in der Schweiz». Die Schau, kuratiert von Jean-Paul Felley und Olivier Kaeser sowie Sévérine Fromaigeat ist eine erweiterte Version eines Festivals, welches das Centre Culturel Suisse in Paris 2015 realisiert hatte. Sie versammelt «über 50 künstlerische Positionen», wie das in den Zeiten der Beliebigkeit genannt wird, um jede Verbindlichkeit zu vermeiden. Ergänzt wird die Präsentation durch eine enge Kooperation mit der Kaserne Basel und der Kunsthalle. Beide Institutionen tragen ihre eigenen Programme zum Projekt bei.
 Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.
Erwartungsgemäss stehen am Anfang des von Video-Sequenzen und Fotografien dominierten Ausstellungs-Parcours im zweiten Stock Jean Tinguelys grandioses Selbstzerstörungs-Happening in New York, das Weltuntergangs-Show in der Wüste von Nevada und andere Spektakel ähnlichen Kalibers. Gemessen an diesen wegweisenden Werken, haben die jüngeren und jüngsten Performances die grösste Mühe, eine eigenständige, über den grassierenden Narzissmus hinaus weisende Wirkung zu entfalten. Wenn einer sich beim Joggen in einem Tunnel filmen lässt, ein anderer Zauberkunststücke zum Besten gibt und ein Dritter alte Herren im Superman-Outfit ins Gelände schickt, weckt das beim Publikum, wenn’s hoch kommt, ein Achselzucken. Die Ausstellung, sorry, dokumentiert nichts als eine grosse Ratlosigkeit. Wenn alles erlaubt ist, und sich niemand mehr provoziert fühlt, wenn sich Performance-Künstlerinnen und -Künstler in erster Linie auf ihren Körper konzentrieren, wie das an der Medien-Vorbesichtigung behauptet wurde, sind kreative Überraschungen nicht zu erwarten. Die Kunsthalle, kündigte Direktorin Elena Filipovic in ihrem Pressetext an, beende ihr Programm «mit einem grossen Finale in den Nachtstunden des 18. Februar 2018 bis hin in den frühen Morgen des 19. Februar 2018, wenn um 4 Uhr morgens alle Lichter der Stadt für den Morgestraich gelöscht werden – dem rituellen Auftakt der Fastnacht (sic!), Basels ganz eigener ‹Kollektiv-Performance›». Kein Witz? Kein Witz.
Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962
Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine

Illustration: Jean Tinguely, Study for an End of the World, N° 2, 1962
Filmstill aus “David Brinkley’s Journal”, NBC, 1962 © LIFE Magazine; Foto: Life Magazine
Wim Delvoye im Museum Tinguely
13.06.17 13:40
Dem belgischen Konzeptkünstler Wim Delvoye, geb. 1965, widmet das Museum Tinguely in Basel vom 13. Juni 2017 bis 1. Januar 2018 die erste grosse Retrospektive in der Schweiz. Die in Zusammenarbeit mit dem MUDAM (Musée d’Art Moderne) in Luxemburg von Andres Pardey kuratierte Schau zeigt Werke eines witzig-kreativen Geistes, der weit mehr kann, als mit seinen inzwischen weltweit berüchtigten Verdauungsmaschinen das Publikum zu provozieren. Das heisst, dass diese aufwändig und wissenschaftlich genau den menschlichen Verdauungsvorgang simulierenden Apparate auch in dieser Ausstellung einen wichtigen Platz einnehmen. Aber sie sind in einen Kontext eingebettet, der die Intention des Künstlers verständlich macht, für alle Menschen, ohne Unterschied der Herkunft und Klasse und für alle gleichermassen lebensnotwendige natürliche Prozesse zu simulieren.  Das Konzept, erläuterte Wim Delvoye bei der Vorbesichtigung, sei stark von seiner Faszination für die Forschung am menschlichen Genom und anderen Errungenschaften der Biomedizin beeinflusst. Wie sich in der Ausstellung zeigt, ist dies allerdings nur eine der Quellen, aus denen sich Delvoyes Imaginationen speisen. Eine zweite sind die traditionellen Handwerke, zum Beispiel die Kunstschnitzerei in Indonesien oder die Porzellanmalerei in Holland. Diese Fertigkeiten nutzt er zur Ironisierung und Verfremdung von Alltagsgegenständen – zum Beispiel, indem er 18 Propangasbehälter wie Delfter Porzellan bemalen oder indem er eine ganze Baustelle mit Schubkarre, Betonmischer und allem weiteren Drum und Dran aus Tropenholz schnitzen lässt. Die dritte Abteilung zelebriert das Ornament in sakraler Brechung: Die nach oben strebende, nach Ansicht von Wim Delvoye, von den europäischen Wäldern inspirierte Gotik als Baustil und Weltanschauung ist hier auf vielfältige Weise präsent: zum Beispiel in den ornamental geschnitzten Lastwagenreifen, in dem «Suppo» genannten, von der Decke hängenden extrem verdrehten neugotischen Kathedralenmodell oder, draussen im Park, im – ebenfalls neugotisch gestalteten – «Cement-Truck», der ganz aus lasergeschnittenen, langsam rostenden Cortenstahl-Platten zusammengesetzt ist.
Das Konzept, erläuterte Wim Delvoye bei der Vorbesichtigung, sei stark von seiner Faszination für die Forschung am menschlichen Genom und anderen Errungenschaften der Biomedizin beeinflusst. Wie sich in der Ausstellung zeigt, ist dies allerdings nur eine der Quellen, aus denen sich Delvoyes Imaginationen speisen. Eine zweite sind die traditionellen Handwerke, zum Beispiel die Kunstschnitzerei in Indonesien oder die Porzellanmalerei in Holland. Diese Fertigkeiten nutzt er zur Ironisierung und Verfremdung von Alltagsgegenständen – zum Beispiel, indem er 18 Propangasbehälter wie Delfter Porzellan bemalen oder indem er eine ganze Baustelle mit Schubkarre, Betonmischer und allem weiteren Drum und Dran aus Tropenholz schnitzen lässt. Die dritte Abteilung zelebriert das Ornament in sakraler Brechung: Die nach oben strebende, nach Ansicht von Wim Delvoye, von den europäischen Wäldern inspirierte Gotik als Baustil und Weltanschauung ist hier auf vielfältige Weise präsent: zum Beispiel in den ornamental geschnitzten Lastwagenreifen, in dem «Suppo» genannten, von der Decke hängenden extrem verdrehten neugotischen Kathedralenmodell oder, draussen im Park, im – ebenfalls neugotisch gestalteten – «Cement-Truck», der ganz aus lasergeschnittenen, langsam rostenden Cortenstahl-Platten zusammengesetzt ist.
Zur Ausstellung erschien ein reich illustrierter Katalog mit sachkundigen deutsch/englischen Texten.
Andres Pardey (Hrsg. für das Museum Tinguely): Wim Delvoye, Paris 2017 (Somogy éditions d’art), 224 Seiten, CHF48.00.
Eine Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Illustration: Wim Delvoye: Ohne Titel (Geschnitzter LKW-Reifen) 2013 (Detail). Foto © Jürg Bürgi, 2017.

Zur Ausstellung erschien ein reich illustrierter Katalog mit sachkundigen deutsch/englischen Texten.
Andres Pardey (Hrsg. für das Museum Tinguely): Wim Delvoye, Paris 2017 (Somogy éditions d’art), 224 Seiten, CHF48.00.
Eine Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Illustration: Wim Delvoye: Ohne Titel (Geschnitzter LKW-Reifen) 2013 (Detail). Foto © Jürg Bürgi, 2017.
Kapelle für Tinguelys «Mengele Totentanz» und ein Vorraum von Jérôme Zonder
07.06.17 16:34
«Mengele Totentanz» nannte Jean Tinguely seine aus Trümmern des im August 1986 abgebrannten Bauernhofes seiner Nachbarn in Neyruz (FR) gestaltete Skulpturengruppe. Sie entstand nach und nach, zuerst der Hochaltar aus einer zur Unkenntlichkeit deformierten Maisernte-Maschine der Marke «Mengele», und die vier «Ministranten»: «der Bischof», «der Fernseher», «die Gemütlichkeit» und «die Schnapsflasche». Während «der Bischof», zusammengebaut aus Motorsäge, Bajonett und Karabinerlauf, Tinguelys Überzeugung von der Komplizenschaft der katholischen Kirche mit der Mord-Maschinerie der Nazis verkörpert, symbolisieren die drei anderen Skulpturen, wie Roland Wetzel im neuen Katalog zur Werkgruppe schreibt, «das Unpolitische». Sie stehen «für den individuellen Rückzug ins Private oder für die Meinungsbildung am Stammtisch, die Mechanismen der Ausgrenzung in Gang setzen kann und damit Populismus und Totalitarismen durch Ignoranz begünstigt». Auch die 13 weiteren Teile versinnbildlichen den Totentanz und ihren Tanzmeister Josef Mengele, der auf der Rampe im Vernichtungslager Auschwitz ungezählte Juden aus ganz Europa in die Gaskammern schickte.
 Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.
Als angemessenen Ausstellungsraum für den «Mengele Totentanz», stellte sich Jean Tinguely zeitlebens eine Kapelle vor, nachdem er das Ensemble 1987 in Venedig, im Rahmen einer Retrospektive im Palazzo Grassi in Venedig in der gegenüber am Canale Grande liegenden Kirche San Samuele präsentiert hatte. Ein Jahr später überzeugte er seine Freunde Paul Sacher und Fritz Gerber, dass die Werkgruppe zusammenbleiben und im besonders totentanz-affinen Basel ausgestellt werden sollte. Tatsächlich kaufte die Firma Hoffmann-La Roche einen Teil der Skulpturen und Tinguely versprach, den verbliebenen Rest der Gruppe beizusteuern. Er entwarf einen Kapellenraum unter Paul Sachers Anwesen auf dem Schönenberg. Als Tinguely 1991 starb, kam das Werk als eines der ersten in das von der Roche finanzierte und von Mario Botta gebaute Tinguely-Museum.
Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.
Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.
Fingerabdruck-Zeichnungen orientieren sich teils an Filmszenen, an tief im kollektiven Gedächtnis verankerten Kriegsbildern oder auch an einer aus dem Basler Kunstmuseum bekannten Totentanz-Darstellung von Hans Baldung Grien (1484-1545) aus der Zeit um 1520. Das kleine, rund 31 mal 19 Zentimeter messende, farbige Tafelbild, hat Zonder überlebensgross schwarz-weiss, neu interpretiert. Auch die übrigen Exponate bestechen durch Zonders einzigartiges Zeichentalent und seine technische Fertigkeit.
Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.
Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.
Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.
Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).
Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).

Was dort bis heute fehlte, war ein ganz auf den «Mengele Totentanz» zugeschnittener Ort. Diesen hat das «Museum Tinguely», wie es nun offiziell und mit frischem Logo heisst, in einem neu eingebauten Raum geschaffen. Tinguely, darf man annehmen, hätte seine Freunde daran: Die neue Kapelle ist dunkel und düster, gerade gross genug, um ein eindrückliches sowohl visuelles als auch akustisches Erlebnis zu ermöglichen.
Es ist ein Glücksfall, dass zur Eröffnung des neuen Ausstellungsraums der Pariser Künstler Jérôme Zonder (*1974) den Vorraum gestaltete. Im Foyer des Totentanzes – in seinem «Dancing Room» – zeigt Zonder vom 6. Juni bis 1. November 2017 eine Art Ballsaal der organisierten und der individuellen Grausamkeit. Drei Seiten sind mit Bildern des Schreckens bedeckt. Die schwarz-weissen Bleistift-, Kohle- und

Auch in Zukunft sollen junge Kunstschaffende Gelegenheit erhalten, den Vorraum zum «Mengele Totentanz» im Dialog mit Tinguelys Werk zu gestalten.
Eine Publikation über Jérôme Zonder aus der édition Galerie Eva Hober, Paris, ist angekündigt.
Zur Neueinrichtung von Tinguelys «Mengele Totentanz» erschien auf Deutsch, Französisch und Englisch eine Publikation mit aktuellen Texten von Sophie Oosterwijk, Sven Keller, Roland Wetzel und dem Nachdruck eines Gesprächs, das Margrit Hahnloser 1988 mit Jean Tinguely über den Totentanz führte.
Museum Tinguely (Hrsg.): Mengele Totentanz. Heidelberg, Berlin 2017 (Kehrer Verlag), 64 Seiten, CHF 24.00 (Museumsausgabe), ca. €22.00 (Buchhandel).
Illustrationen: Jérôme Zonder: Eingangsbereich zum «Mengele Totentanz» © Bild Jürg Bürgi, 2017; unten links: Hans Baldung Grien: Tod und Frau (1518-1520, Kunstmuseum Basel), rechts: Jérôme Zonder: Tod und Frau nach Baldung Grien (2017).
Stephen Cripps im Museum Tinguely
24.01.17 18:59

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Zur Ausstellung erschien – in je einer deutschen und englischen Version – ein sehr ansprechend gestalteter Katalog mit Beiträgen der Kuratorin und weiterer sachkundiger Kenner von Cripps und der britischen Kunstszene der 1970er-Jahre. Als erste umfassende wissenschaftliche Veröffentlichung zum Werk des Künstlers ist die Publikation das Referenzwerk für die weitere Erforschung von Cripps’ Œuvre.
Sandra Beate Reimann (Hrsg. für das Museum Tinguely): Stephen Cripps – Performing Machines. Wien 2017 (VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH), 192 Seiten, CHF 48.00, €38.00
Claude Monet in der Fondation Beyeler
20.01.17 16:30


Zur Ausstellung erschien ein traditionell und sorgfältig gestalteter Katalog mit sechs kenntnisreichen Essays und erläuternden Texten und 130 Abbildungen:
Ulf Küster (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Monet. Riehen/Berlin 2017 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 180 Seiten. CHF 62.50/€ 58.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Illustrationen: Foto-Porträt von Claude Monet in der Ausstellung (Ausschnitt).
«La Cathédrale de Rouen» (1894) im neuen Rahmen. Foto © Jürg Bürgi 2017
Musikmaschinen/Maschinenmusik im Museum Tinguely
18.10.16 13:37
Vom 19. Oktober 2016 bis 22. Januar 2017 präsentiert das Museum Tinguely in Basel zum ersten – und wohl zum einzigen – Mal Jean Tinguelys vier monumentale «Méta-Harmonien» aus den Jahren 1978 bis 1985 als Ensemble. Als erste dieser riesigen Musikmaschinen, die auf einzigartige Weise seine Ansichten über Töne und Klänge, Schall und Lärm illustrieren, konstruierte der Künstler 1978 für die legendäre «Hammer-Ausstellung» des Basler Galeristen Felix Handschin die dreiteilige «Méta-Harmonie», in die er zahlreiche Musikinstrumente einbaute. Sie ist nach Überzeugung der Kuratorin Annja Müller-Alsbach die melodiöseste der im grössten Raum des Museums versammelten Musikmaschinen. Der Mäzen Peter Ludwig war seinerzeit schnell zur Stelle und sicherte sich das Werk, das jetzt zur Sammlung des Museums moderner Kunst, Stiftung Ludwig in Wien gehört.
Im Jahr darauf, als Tinguely gemeinsam mit Bernhard Luginbühl das Frankfurter Städel Museum in Beschlag nehmen durfte, entstand die ähnlich üppig mit Instrumenten bestückte, ebenfalls dreigeteilte «Méta-Harmonie II». Ein ganzes Klavier, eine mit Druckluft betriebene Melodica und zahlreiche Schlaginstrumente sind für die Skulptur charakteristisch. Gleichzeitig baute er um einen alten Bührer-Traktor herum seine Fahrskulptur «Klamauk», die nicht nur lärmte, sondern auch mit Rauch und Knallfröschen auftrumpfte.
 Die Tokioter Warenhauskette «Seibu» gab 1984 mit ihrem Auftrag den Anlass, die Reihe der Méta-Harmonien mit einer Nummer 3 fortzusetzen. Die Maschine fällt – nicht zuletzt wegen der offenbar grosszügigen finanziellen Ausstattung – durch ihre barocke Üppigkeit auf. Co-Kuratorin Sandra Reimann berichtet, dass Tinguely und sein Assistent Seppi Imhof zur Vorbereitung bei Musik Hug in Basel gross Perkussions-Equipment eingekauft hätten. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Maschine zuerst den Namen «Pandämonium» verpasst bekam. Denn sie produziert nicht nur höllische Klänge, sondern bietet auch eine Fülle grotesker visueller Reize – vom Tierschädel bis zur Plastikeule, von der Souvenir-Kuhglocke bis zum Fondue-Caquelon – die mit Hilfe von 52 Elektromotoren in Bewegung gehalten werden. «Pandämonium 1 – Méta-Harmonie 3» gehört zur Sammlung des «Sezon Museum of Modern Art» in Karuizawa, einer als Ausflugsziel und Ferienort beliebten Kleinstadt in der Präfektur Nagano, am Fuss des Mount Asama, eines der aktivsten Vulkane des Landes.
Die Tokioter Warenhauskette «Seibu» gab 1984 mit ihrem Auftrag den Anlass, die Reihe der Méta-Harmonien mit einer Nummer 3 fortzusetzen. Die Maschine fällt – nicht zuletzt wegen der offenbar grosszügigen finanziellen Ausstattung – durch ihre barocke Üppigkeit auf. Co-Kuratorin Sandra Reimann berichtet, dass Tinguely und sein Assistent Seppi Imhof zur Vorbereitung bei Musik Hug in Basel gross Perkussions-Equipment eingekauft hätten. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Maschine zuerst den Namen «Pandämonium» verpasst bekam. Denn sie produziert nicht nur höllische Klänge, sondern bietet auch eine Fülle grotesker visueller Reize – vom Tierschädel bis zur Plastikeule, von der Souvenir-Kuhglocke bis zum Fondue-Caquelon – die mit Hilfe von 52 Elektromotoren in Bewegung gehalten werden. «Pandämonium 1 – Méta-Harmonie 3» gehört zur Sammlung des «Sezon Museum of Modern Art» in Karuizawa, einer als Ausflugsziel und Ferienort beliebten Kleinstadt in der Präfektur Nagano, am Fuss des Mount Asama, eines der aktivsten Vulkane des Landes.
1985 baute Tinguely seine «Méta-Harmonie IV», die Seppi Imhof nach Angaben des Künstlers «Fatamorgana» betitelte. Sie entstand nicht im Atelier, sondern in einer riesigen, nicht mehr benutzten Giesserei-Halle der von Roll in Olten, wo zahlreiche hölzerne Gussformen gelagert waren. Diese farbigen Holzräder prägen den Charakter der über zwölf Meter langen und mehr als vier Meter hohen Skulptur, die zur Sammlung des Museums Tinguely gehört. Eine Kuhglocke, sowie eine Trommel und ein Becken sind die einzigen «Musikinstrumente»; die übrigen akustischen Effekte werden von industriellen Werkstücken erzeugt, darunter Metallfässer, Eisenstücke, Hämmer und Schraubenschlüssel. So entsteht zum gemächlich sich drehenden Räderwerk eine fabrikmässige Geräuschkulisse.
Eine weitere «Méta-Harmonie» ohne Nummerierung entstand um 1980 im gigantischen Gemeinschaftswerk «Le Cyclope» in Milly-le-Forêt. Das Werk ist in der Ausstellung in einem Film zu sehen, der insbesondere zeigt, wie sich die Maschine ins Ensemble der begehbaren Grossskulptur einfügt und mit ihren Kratz- und Schleifgeräuschen zur düsteren Klangkulisse beiträgt.
Neben Tinguelys sechs massiven, breitspurig auftretenden Klangskulpturen ist zu Beginn der Ausstellungszeit eine Wand-Installation des Berner Künstlers Zimoun zu sehen. Sie ist elf Meter lang und sie heisst, was sie ist: «275 prepared dc-motors, filler wire». An jedem der 275 Elektromotörchen rotiert ein ein Meter langer Schweissdraht. Die Drähte schlagen gegen einander und gegen die Wand, was eine rauschende Klangkulisse erzeugt.
Im Lauf des weiteren Verlaufs der Ausstellung werden weitere Künstlerinnen und Künstler als Gäste den Dialog mit Tinguelys «Méta-Harmonien» aufnehmen. Das Begleitprogramm umfasst zahlreiche weitere – zumeist musikalische – Events.- Eine komplette Übersicht bietet die Website des Museums (http://www.tinguely.ch/de/ausstellungen_events/events).
Zur Ausstellung ist zudem eine reich bebilderte Publikation erschienen. Sie enthält neben einer detaillierten Beschreibung der ausgestellten Kunstwerke Texte von Annja Müller-Alsbach, Sandra Beate Reimann und Heidy Zimmermann sowie ein Vorwort von Roland Wetzel.
Hier geht es zur ausführlichen Besprechung von Katalog und Ausstellung.
Illustration «Méta-Harmonie I» (Ausschnitt) © Jürg Bürgi 2016
Im Jahr darauf, als Tinguely gemeinsam mit Bernhard Luginbühl das Frankfurter Städel Museum in Beschlag nehmen durfte, entstand die ähnlich üppig mit Instrumenten bestückte, ebenfalls dreigeteilte «Méta-Harmonie II». Ein ganzes Klavier, eine mit Druckluft betriebene Melodica und zahlreiche Schlaginstrumente sind für die Skulptur charakteristisch. Gleichzeitig baute er um einen alten Bührer-Traktor herum seine Fahrskulptur «Klamauk», die nicht nur lärmte, sondern auch mit Rauch und Knallfröschen auftrumpfte.

1985 baute Tinguely seine «Méta-Harmonie IV», die Seppi Imhof nach Angaben des Künstlers «Fatamorgana» betitelte. Sie entstand nicht im Atelier, sondern in einer riesigen, nicht mehr benutzten Giesserei-Halle der von Roll in Olten, wo zahlreiche hölzerne Gussformen gelagert waren. Diese farbigen Holzräder prägen den Charakter der über zwölf Meter langen und mehr als vier Meter hohen Skulptur, die zur Sammlung des Museums Tinguely gehört. Eine Kuhglocke, sowie eine Trommel und ein Becken sind die einzigen «Musikinstrumente»; die übrigen akustischen Effekte werden von industriellen Werkstücken erzeugt, darunter Metallfässer, Eisenstücke, Hämmer und Schraubenschlüssel. So entsteht zum gemächlich sich drehenden Räderwerk eine fabrikmässige Geräuschkulisse.
Eine weitere «Méta-Harmonie» ohne Nummerierung entstand um 1980 im gigantischen Gemeinschaftswerk «Le Cyclope» in Milly-le-Forêt. Das Werk ist in der Ausstellung in einem Film zu sehen, der insbesondere zeigt, wie sich die Maschine ins Ensemble der begehbaren Grossskulptur einfügt und mit ihren Kratz- und Schleifgeräuschen zur düsteren Klangkulisse beiträgt.
Neben Tinguelys sechs massiven, breitspurig auftretenden Klangskulpturen ist zu Beginn der Ausstellungszeit eine Wand-Installation des Berner Künstlers Zimoun zu sehen. Sie ist elf Meter lang und sie heisst, was sie ist: «275 prepared dc-motors, filler wire». An jedem der 275 Elektromotörchen rotiert ein ein Meter langer Schweissdraht. Die Drähte schlagen gegen einander und gegen die Wand, was eine rauschende Klangkulisse erzeugt.
Im Lauf des weiteren Verlaufs der Ausstellung werden weitere Künstlerinnen und Künstler als Gäste den Dialog mit Tinguelys «Méta-Harmonien» aufnehmen. Das Begleitprogramm umfasst zahlreiche weitere – zumeist musikalische – Events.- Eine komplette Übersicht bietet die Website des Museums (http://www.tinguely.ch/de/ausstellungen_events/events).
Zur Ausstellung ist zudem eine reich bebilderte Publikation erschienen. Sie enthält neben einer detaillierten Beschreibung der ausgestellten Kunstwerke Texte von Annja Müller-Alsbach, Sandra Beate Reimann und Heidy Zimmermann sowie ein Vorwort von Roland Wetzel.
Hier geht es zur ausführlichen Besprechung von Katalog und Ausstellung.
Illustration «Méta-Harmonie I» (Ausschnitt) © Jürg Bürgi 2016
Roni Horn in der Fondation Beyeler
30.09.16 15:45
In sechs Räumen zeigt die Fondation Beyeler in Riehen vom 2. Oktober 2016 bis zum 1. Januar 2017 an beispielhaften Arbeiten aus den letzten 20 Jahren das Werk der amerikanischen Künstlerin Roni Horn. 1955 in New York geboren, wuchs sie im Rockland County, im südlichsten Zipfel des Staates New York auf. Ihr Kunststudium an der Rhode Island School of Design schloss sie 1975 mit dem Bachelor ab, bevor sie an der Yale University in New Haven ihr Master-Studium mit Schwerpunkt Skulptur aufnahm, reiste sie 1975 als 20-jährige zum ersten Mal nach Island. Diese Reise und zahlreiche weitere Aufenthalte auf der Vulkaninsel im Nordatlantik waren prägend für Horns künstlerische Entwicklung. Roni Horn ist ungeachtet ihrer Ausbildung zur plastischen Künstlerin in erster Linie Zeichnerin. Dabei benutzt sie den Zeichenstift nicht nur als künstlerisches Werkzeug, sondern auch als Werkzeug  der Selbstvergewisserung. Das Zeichnen ermöglicht ihr, neue Ideen auszuprobieren, bevor sie sie dann umsetzt – zum Beispiel als eine Art Collage – wie die imposante Galerie von zehn abstrakten Bildern in der Ausstellung zeigen. Ausgangsmaterial sind bei allen mehrere ähnliche Zeichnungen, die dann sorgfältig mit dem Messer zerschnitten und neu zu einem Grossformat zusammengesetzt wurden. Eröffnet wird die Schau aber durch die Foto-Installation «a.k.a.» von 2008/09, eine Sammlung von 30 paarweise präsentierten Porträts der Künstlerin als Kind, Jugendliche und Erwachsene. Da die Bilder nicht chronologisch geordnet sind, bleibt immer ein Rest an Zweifel, ob es sich auf den Fotos immer um die gleiche Person handelt. Besonders beeindruckend fanden wir die neusten Papierarbeiten, die unter dem Titel «Th Rose Prblm» auf vielfältige Weise und in grosser Farbigkeit an Gertrude Steins (1874-1946) meistzitierte Gedichtzeile «Rose is a rose is a rose is a rose» erinnern – und wohl auch als Hommage an die Mutter aller Avantgardisten gedacht. Horn weitet Steins Vorgabe aus, indem sie weitere Redewendungen verwendet, in denen das Wort «Rose» vorkommt. Der Titel, dem sie, wie im Hebräischen, die Vokale bis auf das O in der Rose entzieht, ist ein zusätzliches Aperçu. Im dritten Raum zeigt Kuratorin Theodora Vischer, welche die Schau in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin gestaltete, 15 grossformatige Fotografien des Wassers der Themse. «Still Water (The River Thames, for Example)» entstand 1999. Unterhalb der Bilder platzierte Fussnoten fordern die Betrachtenden auf, nicht nur zu schauen, sondern auch nachzudenken: «Is water sexy?» wird da etwa gefragt, oder es werden Anekdoten über Vorkommnisse in und an der Themse zitiert – alles in einem Tonfall, als ob man einem Selbstgespräch der Künstlerin zuhören würde. Der grösste Raum der Ausstellung ist drei zylindrischen Glasskulpturen-Paaren mit dem Titel «Water-Double» vorbehalten.
der Selbstvergewisserung. Das Zeichnen ermöglicht ihr, neue Ideen auszuprobieren, bevor sie sie dann umsetzt – zum Beispiel als eine Art Collage – wie die imposante Galerie von zehn abstrakten Bildern in der Ausstellung zeigen. Ausgangsmaterial sind bei allen mehrere ähnliche Zeichnungen, die dann sorgfältig mit dem Messer zerschnitten und neu zu einem Grossformat zusammengesetzt wurden. Eröffnet wird die Schau aber durch die Foto-Installation «a.k.a.» von 2008/09, eine Sammlung von 30 paarweise präsentierten Porträts der Künstlerin als Kind, Jugendliche und Erwachsene. Da die Bilder nicht chronologisch geordnet sind, bleibt immer ein Rest an Zweifel, ob es sich auf den Fotos immer um die gleiche Person handelt. Besonders beeindruckend fanden wir die neusten Papierarbeiten, die unter dem Titel «Th Rose Prblm» auf vielfältige Weise und in grosser Farbigkeit an Gertrude Steins (1874-1946) meistzitierte Gedichtzeile «Rose is a rose is a rose is a rose» erinnern – und wohl auch als Hommage an die Mutter aller Avantgardisten gedacht. Horn weitet Steins Vorgabe aus, indem sie weitere Redewendungen verwendet, in denen das Wort «Rose» vorkommt. Der Titel, dem sie, wie im Hebräischen, die Vokale bis auf das O in der Rose entzieht, ist ein zusätzliches Aperçu. Im dritten Raum zeigt Kuratorin Theodora Vischer, welche die Schau in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin gestaltete, 15 grossformatige Fotografien des Wassers der Themse. «Still Water (The River Thames, for Example)» entstand 1999. Unterhalb der Bilder platzierte Fussnoten fordern die Betrachtenden auf, nicht nur zu schauen, sondern auch nachzudenken: «Is water sexy?» wird da etwa gefragt, oder es werden Anekdoten über Vorkommnisse in und an der Themse zitiert – alles in einem Tonfall, als ob man einem Selbstgespräch der Künstlerin zuhören würde. Der grösste Raum der Ausstellung ist drei zylindrischen Glasskulpturen-Paaren mit dem Titel «Water-Double» vorbehalten.  Die viele Tonnen schweren Gebilde sind alle gleich gross, aber von verschiedener Farbe. Sie wirken mächtig durch ihre Masse und vermitteln paradoxerweise gleichzeitig den Eindruck von Zerbrechlichkeit – weil wir Glas spontan als fragil erleben. Von allen Exponaten lässt sich bei dieser Arbeit am ehesten die Inspiration durch die isländische, von Wasser, Eis und Vulkanasche geprägte Landschaft vorstellen. An den Schluss der Schau haben die Ausstellungsmacherinnen eine zweite, ganz neue und erstmals gezeigte Porträtarbeit gestellt. Der Raum präsentiert 67 einzelne, in Gruppen arrangierte Fotografien von Objekten, die Roni Horn zwischen 1974 und 2015 zum Geschenk gemacht wurden. Es sind Bücher darunter, aber auch ein Liebesbrief, das versteinerte Ei eines Dinosauriers oder ein ausgestopfter Schwan. In der Summe, ist die Künstlerin überzeugt, lässt sich dieses Inventar von Geschenken und Mitbringseln auch als Selbstporträt lesen.
Die viele Tonnen schweren Gebilde sind alle gleich gross, aber von verschiedener Farbe. Sie wirken mächtig durch ihre Masse und vermitteln paradoxerweise gleichzeitig den Eindruck von Zerbrechlichkeit – weil wir Glas spontan als fragil erleben. Von allen Exponaten lässt sich bei dieser Arbeit am ehesten die Inspiration durch die isländische, von Wasser, Eis und Vulkanasche geprägte Landschaft vorstellen. An den Schluss der Schau haben die Ausstellungsmacherinnen eine zweite, ganz neue und erstmals gezeigte Porträtarbeit gestellt. Der Raum präsentiert 67 einzelne, in Gruppen arrangierte Fotografien von Objekten, die Roni Horn zwischen 1974 und 2015 zum Geschenk gemacht wurden. Es sind Bücher darunter, aber auch ein Liebesbrief, das versteinerte Ei eines Dinosauriers oder ein ausgestopfter Schwan. In der Summe, ist die Künstlerin überzeugt, lässt sich dieses Inventar von Geschenken und Mitbringseln auch als Selbstporträt lesen.
Im Verlauf der Ausstellung erscheint eine Broschüre mit einem Gespräch Theodora Vischers mit der Künstlerin und Installationsaufnahmen der Ausstellung. Zudem steht ein Heft mit Saaltexten zur Verfügung.
Illustrationen: Oben: «Th Rose Prblm» (2015/2016), unten: «Water Double, v 1-v. 3 (2013-2016). Fotos aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, Basel.


Im Verlauf der Ausstellung erscheint eine Broschüre mit einem Gespräch Theodora Vischers mit der Künstlerin und Installationsaufnahmen der Ausstellung. Zudem steht ein Heft mit Saaltexten zur Verfügung.
Illustrationen: Oben: «Th Rose Prblm» (2015/2016), unten: «Water Double, v 1-v. 3 (2013-2016). Fotos aus der Ausstellung © Jürg Bürgi, Basel.
Der Blaue Reiter in der Fondation Beyeler
03.09.16 08:41

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gib es hier.
Zur Einführung in die Ausstellung dient im ersten Saal eine animierte Wandprojektion, mit der die Künstlerinnen und Künstler und ihre Wirkungsstätten vorgestellt werden. Zudem bietet die Fondation Beyeler ein vielfältiges Begleitprogramm mit Workshops, Vorträgen, Lesungen und einem Konzert und Führungen.
Zur Ausstellung erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe ein sehr schön gestalteter Katalog: Ulf Küster (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Kandinsky, Marc und Der Blaue Reiter. Riehen/Ostfildern 2016 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 188 Seiten, CHF 62.50/€58.00
Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow im Schaulager in Münchenstein
10.06.16 16:24
Wenn zwei Künstler eine Zusammenarbeit vereinbaren, heisst das nicht, dass sie sich gemeinsam an einem Ort an die Arbeit machen. Der kreative Prozess, zeigt sich auch am Projekt «Zita – Щара. Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow», das vom 12. Juni bis zum 2. Oktober 2016 im Schaulager in Münchenstein bei Basel zu sehen ist, verläuft eigenwillig und widersetzt sich gewöhnlich jeder banalen Kooperation. «Zita», der Beitrag, den die 1956 in Essen geborene Künstlerin zum «Kammerstück» beisteuert, nimmt Bezug auf die letzte Kaiserin der am Ende des Ersten Weltkriegs untergegangenen Habsburger Monarchie.  Er besteht aus zwei leuchtend farbigen Werken. Das erste, eine Gruppe von drei Figuren – zwei Bauernfrauen und ein Bauernkind, den kleinen, kunstvoll aus Maisstroh gefertigten Figuren aus dem Repertoire des traditionellen slowakischen Kunsthandwerks nachgebildet – ist im ersten von drei Räumen eines eigens für diese Präsentation im Erdgeschoss des Schaulagers aufgebauten Gehäuses platziert. Die mit der Spritzpistole leuchtend gelb pigmentierten Gestalten sind das Erste, was die Besucher sehen – eine Art Begrüssungskomitee, dem Publikum frontal zugewandt. Zuvorderst steht das Kind mit einem grünen Ball, dahinter die Magd mit Besen und roter Schürze, daneben die Mutter mit einem weissen Tuch über dem rechten Arm. Wer sich im Raum umsieht, erkennt allerdings, dass die Figuren ihre Aufmerksamkeit nicht nur den Ankömmlingen zuwenden, sondern auch dem rechts vom schmalen Eingang platzierten Kachelofen. Die Tür zum Feuerraum ist offen. Zu sehen ist ein Feuerschein und einige
Er besteht aus zwei leuchtend farbigen Werken. Das erste, eine Gruppe von drei Figuren – zwei Bauernfrauen und ein Bauernkind, den kleinen, kunstvoll aus Maisstroh gefertigten Figuren aus dem Repertoire des traditionellen slowakischen Kunsthandwerks nachgebildet – ist im ersten von drei Räumen eines eigens für diese Präsentation im Erdgeschoss des Schaulagers aufgebauten Gehäuses platziert. Die mit der Spritzpistole leuchtend gelb pigmentierten Gestalten sind das Erste, was die Besucher sehen – eine Art Begrüssungskomitee, dem Publikum frontal zugewandt. Zuvorderst steht das Kind mit einem grünen Ball, dahinter die Magd mit Besen und roter Schürze, daneben die Mutter mit einem weissen Tuch über dem rechten Arm. Wer sich im Raum umsieht, erkennt allerdings, dass die Figuren ihre Aufmerksamkeit nicht nur den Ankömmlingen zuwenden, sondern auch dem rechts vom schmalen Eingang platzierten Kachelofen. Die Tür zum Feuerraum ist offen. Zu sehen ist ein Feuerschein und einige  schwarze Holzscheite. Doch die von Alexej Koschkarow geschaffene, glänzend weiss bemalte Ofen-Skulptur irritiert nicht nur durch den gefährlich offenen Feuerraum, sondern durch ihre ganze Gestalt: eine explodierende Handgranate. Folgen wir der Dramaturgie des «Kammerstücks» von Fritsch und Koschkarow, so findet in diesem Raum der erste Akt statt, repräsentiert durch die (nur angeblich) heile Welt im weitläufigen Kakanien, die durch den Ersten Weltkrieg beendet wird. Die Kaisersgattin Zita, geborene von Bourbon und Parma, lebte fortan im Exil und starb 96-jährig 1989 im Johannes-Stift in Zizers im Kanton Graubünden. Bei der Einbalsamierung der Leiche in Chur wurde das Herz entnommen und in der
schwarze Holzscheite. Doch die von Alexej Koschkarow geschaffene, glänzend weiss bemalte Ofen-Skulptur irritiert nicht nur durch den gefährlich offenen Feuerraum, sondern durch ihre ganze Gestalt: eine explodierende Handgranate. Folgen wir der Dramaturgie des «Kammerstücks» von Fritsch und Koschkarow, so findet in diesem Raum der erste Akt statt, repräsentiert durch die (nur angeblich) heile Welt im weitläufigen Kakanien, die durch den Ersten Weltkrieg beendet wird. Die Kaisersgattin Zita, geborene von Bourbon und Parma, lebte fortan im Exil und starb 96-jährig 1989 im Johannes-Stift in Zizers im Kanton Graubünden. Bei der Einbalsamierung der Leiche in Chur wurde das Herz entnommen und in der  Familiengruft im Kloster Muri im Kanton Aargau (in dem auch das Stammhaus der Familie, die Habsburg, steht) bestattet. Die Trauerfeier im Wiener Stephansdom und die Überführung des Sarges in die Kaisergruft wurde in einer fünfstündigen Zeremonie mit allergrösstem Pomp und in Anwesenheit der gesamten Nomenklatura der Republik Österreich durchgeführt. Im Wissen um diese groteske Geschichte ist der aus billiger MDF-Platte hergestellte blaue Sarg auf orangen Böcken, mit dem Katharina Fritsch im zweiten Raum Zitas Auftritt in dem Kammerstück endgültig beendet.
Familiengruft im Kloster Muri im Kanton Aargau (in dem auch das Stammhaus der Familie, die Habsburg, steht) bestattet. Die Trauerfeier im Wiener Stephansdom und die Überführung des Sarges in die Kaisergruft wurde in einer fünfstündigen Zeremonie mit allergrösstem Pomp und in Anwesenheit der gesamten Nomenklatura der Republik Österreich durchgeführt. Im Wissen um diese groteske Geschichte ist der aus billiger MDF-Platte hergestellte blaue Sarg auf orangen Böcken, mit dem Katharina Fritsch im zweiten Raum Zitas Auftritt in dem Kammerstück endgültig beendet.
Der Doppeltitel der Ausstellung – «Zita – Щара» – weist daraufhin, dass Alexej Koschkarow, 1972 in Minsk (Weissrussland) geboren, dort und in Düsseldorf ausgebildet, mit Zita, dem scheinbar unverwüstlichen Symbol der Donaumonarchie, wenig anzufangen weiss – zumal die Erinnerungen an das Erste und Zweite Weltkriegsgeschehen am Fluss Schtschara (Щара) und in ganz Weissrussland nicht nur in seiner Familie noch sehr lebendig sind. So trennen sich die Wege der Künstlerin und des Künstlers schon nach dem ersten Raum. Den dritten bespielt Koschkarow, der in New York lebt und arbeitet, mit eigenen Werken, von denen er eines, «Das was keinen Namen hat» genannt, eigens für diese Ausstellung konzipiert hat. Es handelt sich um eine über zwei Meter hohe, schwarz-weisse Skulptur. Man kann sich gut vorstellen, das Kunst-Stück als Modell eines riesigen, begehbaren Denkmals zu sehen, dessen oberer Teil über Treppen und eine tunnelartige Zufahrt erreichbar ist. Dort öffnet sich, auf eine Seite hin, wie das aufgerissene Maul eines Molochs die Eingangshalle einer Festungsanlage, die von Geschütz-Scharten mit ihren Deckungen gekrönt wird. Und zuoberst, rings um den turmartigen Ausguck, halten drei kräftige, mit Kugeln und Stöcken bewaffnete, behelmte, nackte Amazonen mit drei Kampfhunden Ausschau. Gleich gegenüber diesem standfesten Sinnbild der Brutalität hat Koscharow seine Skulptur «Schtetl» platziert. Der aus kleinen Holzstücken zusammengesetzte, eigentlich Frieden und idyllische Harmonie ausstrahlende Häuserhaufen ist sofort als bedroht zu erkennen. Die ganze Anlage steht auf gebrochenen und notdürftig geflickten Stelzen. Und in der Mitte der Siedlung ist ein gewaltiges Beil zu sehen. Im Unterschied zum Schwert von Dionysos II. von Syrakus, unter dem der Schmeichler Damokles zum Festmahl geladen wurde, hat das Beil im
eigens für diese Ausstellung konzipiert hat. Es handelt sich um eine über zwei Meter hohe, schwarz-weisse Skulptur. Man kann sich gut vorstellen, das Kunst-Stück als Modell eines riesigen, begehbaren Denkmals zu sehen, dessen oberer Teil über Treppen und eine tunnelartige Zufahrt erreichbar ist. Dort öffnet sich, auf eine Seite hin, wie das aufgerissene Maul eines Molochs die Eingangshalle einer Festungsanlage, die von Geschütz-Scharten mit ihren Deckungen gekrönt wird. Und zuoberst, rings um den turmartigen Ausguck, halten drei kräftige, mit Kugeln und Stöcken bewaffnete, behelmte, nackte Amazonen mit drei Kampfhunden Ausschau. Gleich gegenüber diesem standfesten Sinnbild der Brutalität hat Koscharow seine Skulptur «Schtetl» platziert. Der aus kleinen Holzstücken zusammengesetzte, eigentlich Frieden und idyllische Harmonie ausstrahlende Häuserhaufen ist sofort als bedroht zu erkennen. Die ganze Anlage steht auf gebrochenen und notdürftig geflickten Stelzen. Und in der Mitte der Siedlung ist ein gewaltiges Beil zu sehen. Im Unterschied zum Schwert von Dionysos II. von Syrakus, unter dem der Schmeichler Damokles zum Festmahl geladen wurde, hat das Beil im  menschenleeren Schtetl schon eingeschlagen: Es steckt tief in einem Baumstrunk. Obwohl die beiden Werke in diesem Raum ohne Bezug zu einander entstanden sind – «Schtetl» von 2012 gehört zur Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung und ist als Dauerleihgabe im Basler Kunstmuseum deponiert – entsteht eine intensive, beklemmende Spannung zwischen ihnen. Sie wird noch verstärkt durch die an der Wand hängenden, vom Künstler «Smearings» genannten grauen Frottagen «Höllentor» (2012) und «Bellevue» (2014). Wer will, darf die beiden grossformatigen Leinwände als Abschluss des Kammerstücks betrachten und einen Bezug zum Anfang der Schau herstellen – zumal der Doppeladler sowohl als Symbol Österreich-Ungarns als auch – neuerdings wieder – der Russischen Föderation dient.
menschenleeren Schtetl schon eingeschlagen: Es steckt tief in einem Baumstrunk. Obwohl die beiden Werke in diesem Raum ohne Bezug zu einander entstanden sind – «Schtetl» von 2012 gehört zur Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung und ist als Dauerleihgabe im Basler Kunstmuseum deponiert – entsteht eine intensive, beklemmende Spannung zwischen ihnen. Sie wird noch verstärkt durch die an der Wand hängenden, vom Künstler «Smearings» genannten grauen Frottagen «Höllentor» (2012) und «Bellevue» (2014). Wer will, darf die beiden grossformatigen Leinwände als Abschluss des Kammerstücks betrachten und einen Bezug zum Anfang der Schau herstellen – zumal der Doppeladler sowohl als Symbol Österreich-Ungarns als auch – neuerdings wieder – der Russischen Föderation dient.
Wie eingangs angemerkt: Das Zusammenspiel der Arbeiten von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow ist reine Interpretationssache. Wie die Schönheit liegt es gänzlich im Auge des Betrachters. Der grosse intellektuelle Aufwand, die künstlerischen Leistungen der beiden unter einen Hut zu zwingen, scheint uns übertrieben. Es ginge einfacher und ehrlicher, und der Ernsthaftigkeit der Künstlerin und des Künstlers angemessener: Wie der grossartige Bildteil des Katalogs nämlich belegt, gibt es zwischen den beiden durchaus zahlreiche Gemeinsamkeiten. Sie betreffen weniger die Sujets, die Art ihrer Inspiration, als vielmehr der ungeheuren Sorgfalt, mit der sie ihre Ideen formen, variieren und schliesslich mit grösstem handwerklichem Geschick umsetzen. Es ist selten, dass man in der Publikation zu einer Ausstellung einen so tiefen Einblick in kreative Prozesse nehmen kann.
Die Ausstellung «Zita – Щара, Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow», ist vom 12. Juni bis 2. Oktober 2016 im Schaulager, Ruchfeldstr. 19 in Münchenstein bei Basel zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag 13-19 Uhr, Freitag bis Sonntag 11-17 Uhr.
Der Eintritt ist kostenlos.
Katalog: Laurenz-Stiftung. Schaulager (Hrsg.): Zita – Щара, Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow. Mit Beiträge von Jacqueline Burckhardt, Robert Fleck, Julian Heynen und Michael Rooks. Münchenstein/Basel 2016. 168 Seiten, zweisprachig D/E, CHF 28.00
Fotos © 2016 Jürg Bürgi. Von oben nach unten: «Puppen» (Katharina Fritsch, 2016), «Kalter Ofen» (Alexei Koschkarow, 2016), «Sarg» (Katharina Fritsch, 2016), «Das was keinen Namen hat» (Alexei Koschkarow, 2016), «Schtetl» (Alexei Koschkarow, 2014), «Bellevue» (Alexei Koschkarow, 2014).



Der Doppeltitel der Ausstellung – «Zita – Щара» – weist daraufhin, dass Alexej Koschkarow, 1972 in Minsk (Weissrussland) geboren, dort und in Düsseldorf ausgebildet, mit Zita, dem scheinbar unverwüstlichen Symbol der Donaumonarchie, wenig anzufangen weiss – zumal die Erinnerungen an das Erste und Zweite Weltkriegsgeschehen am Fluss Schtschara (Щара) und in ganz Weissrussland nicht nur in seiner Familie noch sehr lebendig sind. So trennen sich die Wege der Künstlerin und des Künstlers schon nach dem ersten Raum. Den dritten bespielt Koschkarow, der in New York lebt und arbeitet, mit eigenen Werken, von denen er eines, «Das was keinen Namen hat» genannt,



Wie eingangs angemerkt: Das Zusammenspiel der Arbeiten von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow ist reine Interpretationssache. Wie die Schönheit liegt es gänzlich im Auge des Betrachters. Der grosse intellektuelle Aufwand, die künstlerischen Leistungen der beiden unter einen Hut zu zwingen, scheint uns übertrieben. Es ginge einfacher und ehrlicher, und der Ernsthaftigkeit der Künstlerin und des Künstlers angemessener: Wie der grossartige Bildteil des Katalogs nämlich belegt, gibt es zwischen den beiden durchaus zahlreiche Gemeinsamkeiten. Sie betreffen weniger die Sujets, die Art ihrer Inspiration, als vielmehr der ungeheuren Sorgfalt, mit der sie ihre Ideen formen, variieren und schliesslich mit grösstem handwerklichem Geschick umsetzen. Es ist selten, dass man in der Publikation zu einer Ausstellung einen so tiefen Einblick in kreative Prozesse nehmen kann.
Die Ausstellung «Zita – Щара, Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow», ist vom 12. Juni bis 2. Oktober 2016 im Schaulager, Ruchfeldstr. 19 in Münchenstein bei Basel zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag 13-19 Uhr, Freitag bis Sonntag 11-17 Uhr.
Der Eintritt ist kostenlos.
Katalog: Laurenz-Stiftung. Schaulager (Hrsg.): Zita – Щара, Kammerstück von Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow. Mit Beiträge von Jacqueline Burckhardt, Robert Fleck, Julian Heynen und Michael Rooks. Münchenstein/Basel 2016. 168 Seiten, zweisprachig D/E, CHF 28.00
Fotos © 2016 Jürg Bürgi. Von oben nach unten: «Puppen» (Katharina Fritsch, 2016), «Kalter Ofen» (Alexei Koschkarow, 2016), «Sarg» (Katharina Fritsch, 2016), «Das was keinen Namen hat» (Alexei Koschkarow, 2016), «Schtetl» (Alexei Koschkarow, 2014), «Bellevue» (Alexei Koschkarow, 2014).
Michael Landy im Museum Tinguely Basel
07.06.16 19:21
Michael Landy, 1963 in London geboren, aufgewachsen und ausgebildet, erhält vom 8. Juni bis zum 25. September 2016 Gelegenheit, sein ganzes bisheriges künstlerisches Schaffen im Museum Tinguely in Basel zu präsentieren. Sein sagenhafter Akt der Selbstentäusserung, mit dem er 2001 unter dem Titel «Break Down» seine 7227 damaligen Besitztümer mit Unterstützung von zehn Helfern zuerst inventarisierte und dann zerstörte – und dem wir 2010 anlässlich der Ausstellung «Under Destruction» am  gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.
gleichen Ort den «Pokal im Wettbewerb um die radikalste Aktion im Kampf zwischen Sein und Haben» zuerkannten – ist in der aktuellen Schau zwar weiterhin zentral präsent, er bildet jedoch nur eine von zahlreichen wohl durchdachten Manifestationen, mit denen sich Landy gegen die existenziellen Herausforderungen einer ungerechten Welt auflehnt. «DerAusstellungstitel ‹Out of Oder› und seine unterschiedlichen Bedeutungen», schreibt Museumsdirektor Roger Wetzel in der Einleitung zum Katalog, «konterkarieren ein Grundprinzip westlicher Konsumgesellschaften. Innovation und Erneuerungen stehen (geplanter) Obsoleszenz und dem Verschleiss durch Gebrauch (und Nicht-Gebrauch) gegenüber.» Verschlissen werden längst nicht nur Gegenstände, obsolet werden auch Menschen – wie Landy es am Beispiel seines, durch einen Arbeitsunfall invalid gewordenen Vaters eindrücklich darstellt. 1995 erfand er mit der Aktion «Scrapheap Services» eine allgemein gültige Metapher für diese organisierte Missachtung der Menschenwürde, indem er eine Putzequipe tausende von Papierfigürchen zusammenkehren und einen Teil dieser Fetzenhaufen zur Erinnerung in einem Glaszylinder aufspiessen liess. Auch an zahlreichen anderen Stellen der Ausstellung zeigt sich, mit wie viel Witz der Künstler seine Botschaften vermittelt. Gewiss: Es ist immer ein bissiger Humor, der uns hier begegnet – und den man in Basel besonders zu schätzen weiss. Das führt auf direktem Weg zu Jean Tinguely, als dessen grosser Bewunderer sich Landy erweist. Als junger Mann faszinierte ihn 1982 die spontane Bereitschaft der Besucher, bei der One-Man-Show in der Tate-Gallery mit den Maschinen zu spielen. Und später befasste er sich intensiv mit Tinguelys legendärem Zerstörungsspektakel «Homage à New York»: Er suchte Überbleibsel der Aktion von 1960; er befragte Zeitzeugen, und er versuchte eine Rekonstruktion des Ereignisses. Wie sich auf dem als Gang zwischen leeren Marktständen inszenierten Parcours zeigt, interessierte sich Michael Landy in den letzten Jahren auch für Heilige und andere fromme Menschen, deren legendäres Leben durch ihr dramatisches Scheitern geprägt war. Anlass dazu gab ihm die Konfrontation mit Gemälden aus dem 15. und 16. Jahrhundert, die er 2010 bis 2013 als «Artist in Residence» in der Londoner «National Gallery» täglich um sich hatte. Es entstanden zahlreiche Gemälde und überlebensgrosse, zum Teil motorisierte Skulpturen. Insgesamt beeindruckt die von Andres Pardey und Michael Landy gemeinsam kuratierte Ausstellung «Out of Order» als wohl durchdachte, mit Witz, Intelligenz und grosser Sorgfalt gestaltete Werkschau. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur verfügung.
Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.
Illustration © Jürg Bürgi 2016

Andres Pardey (Hrsg, für das Museum Tinguely, Basel): Michael Landy. Out of Order. Basel/Heidelberg 2016 (Museum Tinguely/Kehrer Verlag). 240 Seiten, CHF 48.00. Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.
Illustration © Jürg Bürgi 2016
Neu im Vitra-Campus: Das Schaudepot
02.06.16 10:23


Die Eröffnung des Schaudepots hat den praktischen Nebeneffekt, dass der Vitra Campus an seiner Südseite zur Stadt Weil hin geöffnet wird. Das Gelände wird damit von der Endstation der 8er-Tramlinie der Basler Verkehrsbetriebe (und auch vom Bahnhof Weil der DB) bequem zu Fuss erreichbar.
Das Schaudepot des Vitra Design Museums ist ab 4. Juni 2016 für das Publikum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Illustrationen © Jürg Bürgi, 2016
Alexander Calder mit Fischli/Weiss in der Fondation Beyeler
28.05.16 11:36
Es war die Idee der Kuratorin Theodora Vischer, das Werk von Alexander Calder (1898-1976), dem amerikanischen Altmeister des prekären Gleichgewichts, mit dem Schaffen des ebenfalls von der Equlibristik faszinierten Schweizer Künstler-Duos Peter Fischli (geb. 1952) und David Weiss (1946-2012) in einer gemeinsamen Schau zusammenzuführen. Die Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel dauert vom 29. Mai bis zum 4. September 2016. Zu sehen sind 100 Exponate in 12 Räumen. Der Parcours beginnt im Foyer mit einer – distanzierten – Begegnung der Kinderkostüme von Ratte und Pandabär, den Alter Egos von Fischli und Weiss mit Calders «Otto’s Mobile» von 1952. Und im ersten Saal geht die Konfrontation weiter: Im Vordergrund sind Werke aus der vergleichsweise bodenständigen Serie «Walls, Corners, Tubes», die teils aus ungebranntem Lehm, teils aus 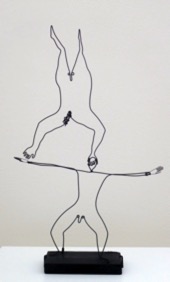
schwarzem Gussgummi gefertigt sind. Sie stehen im Kontrast zu Calders filigraner Seiltanz-Installation «Tightrope» von 1936. Die folgenden vier Räume sind ganz Calder vorbehalten, dem, wie sich zeigt, in der Ausstellung eindeutig der Lead zukommt. Das zeigt sich besonders am grössten Saal, in dem zwei Dutzend Skulpturen und Mobiles zu einem imposanten Panorama der besonders fruchtbaren Schaffenszeit von 1930 bis 1950 zusammengestellt sind. Inspiriert wurde dieser zentrale Teil der Ausstellung und die Auswahl der gezeigten Werke von einer Präsentation am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, die Calder 1950 selbst inszeniert hatte. Davor ist von Fischli/Weiss ihr populärstes Werk, der Film «Der Lauf der Dinge» zu sehen – zum ersten Mal zusammen mit einer Vitrine von Überbleibseln der ebenso witzigen wie faszinierenden Kettenreaktion. Der Raum daneben vermittelt unter dem Titel «Equilibres (Stiller Nachmittag)»anhand von Schnappschüssen von waghalsigen Gleichgewichts-Arrangements aus Alltagsgegenständen, wie die Idee zum «Lauf der Dinge» gewachsen ist. Etwas abseits der Fondation, auf einem Pflanzblätz am Bachtelenwegli, ist ein Projekt auferstanden, das Fischli/Weiss 1997 in Münster im Rahmen einer Skulpturenausstellung erstmals realisiert hatten: ein sorgfältig angelegter Bauerngarten mit Blumen und Gemüse,mit Sitzplatz und Geräteschuppen. Es fällt nicht schwer, darin das ideale Gleichgewicht zwischen Natur und menschlichem Handeln zu erkennen. Leider ist die Gewöhnlichkeit des Projekts so gross, dass – wie Patrick Frey schon vor knapp 20 Jahre formulierte – «die künstlerische Arbeit … als solche von vielen Besucherinnen und Besuchern gar nicht erkannt wird». In Riehen kommt erschwerend hinzu, dass es mangels angemessener Signalisation besonderer Anstrengung bedarf, den Garten zu finden.
Bauerngarten mit Blumen und Gemüse,mit Sitzplatz und Geräteschuppen. Es fällt nicht schwer, darin das ideale Gleichgewicht zwischen Natur und menschlichem Handeln zu erkennen. Leider ist die Gewöhnlichkeit des Projekts so gross, dass – wie Patrick Frey schon vor knapp 20 Jahre formulierte – «die künstlerische Arbeit … als solche von vielen Besucherinnen und Besuchern gar nicht erkannt wird». In Riehen kommt erschwerend hinzu, dass es mangels angemessener Signalisation besonderer Anstrengung bedarf, den Garten zu finden.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs folgt demnächst hier.
Zur Ausstellung ist ein sehr schön gestalteter und überaus informativer Katalog erschienen: Theodora Vischer (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Alexander Calder & Fischli/Weiss. Museumsausgabe: Riehen 2016 (Fondation Beyeler), Buchhandelsausgabe: Ostfildern (Hatje Cantz Verlag), 272 Seiten CHF 62.50 (Museumsausgabe). Der Katalog ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar.
Illustrationen: Alexander Calder: «Two Acrobat» 1929 (oben); Fischli/Weiss: «Stiller Nachmittag» 1994 (unten). © Jürg Bürgi, 2016 (Bilder in der Ausstellung fotografiert).
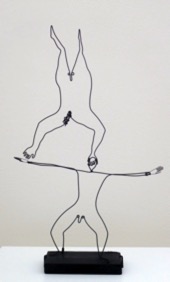
schwarzem Gussgummi gefertigt sind. Sie stehen im Kontrast zu Calders filigraner Seiltanz-Installation «Tightrope» von 1936. Die folgenden vier Räume sind ganz Calder vorbehalten, dem, wie sich zeigt, in der Ausstellung eindeutig der Lead zukommt. Das zeigt sich besonders am grössten Saal, in dem zwei Dutzend Skulpturen und Mobiles zu einem imposanten Panorama der besonders fruchtbaren Schaffenszeit von 1930 bis 1950 zusammengestellt sind. Inspiriert wurde dieser zentrale Teil der Ausstellung und die Auswahl der gezeigten Werke von einer Präsentation am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, die Calder 1950 selbst inszeniert hatte. Davor ist von Fischli/Weiss ihr populärstes Werk, der Film «Der Lauf der Dinge» zu sehen – zum ersten Mal zusammen mit einer Vitrine von Überbleibseln der ebenso witzigen wie faszinierenden Kettenreaktion. Der Raum daneben vermittelt unter dem Titel «Equilibres (Stiller Nachmittag)»anhand von Schnappschüssen von waghalsigen Gleichgewichts-Arrangements aus Alltagsgegenständen, wie die Idee zum «Lauf der Dinge» gewachsen ist. Etwas abseits der Fondation, auf einem Pflanzblätz am Bachtelenwegli, ist ein Projekt auferstanden, das Fischli/Weiss 1997 in Münster im Rahmen einer Skulpturenausstellung erstmals realisiert hatten: ein sorgfältig angelegter

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs folgt demnächst hier.
Zur Ausstellung ist ein sehr schön gestalteter und überaus informativer Katalog erschienen: Theodora Vischer (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Alexander Calder & Fischli/Weiss. Museumsausgabe: Riehen 2016 (Fondation Beyeler), Buchhandelsausgabe: Ostfildern (Hatje Cantz Verlag), 272 Seiten CHF 62.50 (Museumsausgabe). Der Katalog ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar.
Illustrationen: Alexander Calder: «Two Acrobat» 1929 (oben); Fischli/Weiss: «Stiller Nachmittag» 1994 (unten). © Jürg Bürgi, 2016 (Bilder in der Ausstellung fotografiert).
Alexander Girard im Vitra Design Museum
15.03.16 11:28
Seine herausragende Stellung in der Geschichte der Innenarchitektur und des Textil-Designs des 20. Jahrhunderts verdankt der 1907 in New York als Sohn eines französisch-italienischen Vaters und einer amerikanischen Mutter geborene und in Italien und England aufgewachsene Alexander (Sandro) Girard der Tatsache, dass er sehr früh damit begann, seine Interieurs gegen den herrschenden Trend der kühlen Sachlichkeit farbenfröhlich und mit Motiven aus der Volkskunst zu gestalten. Die erste umfassende Rückschau auf sein Werk, die Kurator Jochen Eisenbrand aufgrund des privaten Nachlasses vom 12. März 2016 bis zum 29. Januar 2017 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein präsentiert, zeugt von einzigartiger Kreativität und einer unerhörten Schaffenskraft. Girard plante Häuser und ganze Inneneinrichtungen, darunter das Restaurant «La Fonda del Sol» in New York. Er gestaltete komplette Firmenauftritte – zum Beispiel das Erscheinungsbild der «Braniff International Airlines», die sich damit brüstete, das Ende des schlichten, unattraktiven Flugzeugs («The end of the plain plane») herbeigeführt zu haben– und er entwarf für Herman Miller unzählige Stoff-Kollektionen und Wanddekorationen für Grossraumbüros, die sogenannten «Environmental Enrichment Panels». Girard liess sich von der Natur, von Landschaften und von der Volkskunst inspirieren, denen er auf ausgedehnten Reisen in Europa, Afrika, Asien und vor allem in Nord- und Südamerika begegnete. Seine Sammlung von Volkskunst aus der ganzen Welt umfasste am Schluss nahezu 100’000 Objekte. Zur Pflege und Erforschung dieser immensen Kollektion, die er auch in mehreren grossen Ausstellungen kunstvoll zu inszenieren wusste, gründete er mit seiner Frau 1961 die Girard Foundation. Der Ausstellung im Vitra Design Museum, die das Londoner Design-Studio «Raw Edges» gestaltete, gelingt es, die ganze Vielfalt von Girards gestalterischem Universum fassbar zu machen. Und der von Jochen Eisenbrand herausgegebene und konzipierte prächtige Katalog ist nichts weniger als das wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Inventar eines für die moderne Geschichte der Gebrauchskunst ebenso einzigartigen wie richtungsweisenden Lebenswerks. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.
dass er sehr früh damit begann, seine Interieurs gegen den herrschenden Trend der kühlen Sachlichkeit farbenfröhlich und mit Motiven aus der Volkskunst zu gestalten. Die erste umfassende Rückschau auf sein Werk, die Kurator Jochen Eisenbrand aufgrund des privaten Nachlasses vom 12. März 2016 bis zum 29. Januar 2017 im Vitra Design Museum in Weil am Rhein präsentiert, zeugt von einzigartiger Kreativität und einer unerhörten Schaffenskraft. Girard plante Häuser und ganze Inneneinrichtungen, darunter das Restaurant «La Fonda del Sol» in New York. Er gestaltete komplette Firmenauftritte – zum Beispiel das Erscheinungsbild der «Braniff International Airlines», die sich damit brüstete, das Ende des schlichten, unattraktiven Flugzeugs («The end of the plain plane») herbeigeführt zu haben– und er entwarf für Herman Miller unzählige Stoff-Kollektionen und Wanddekorationen für Grossraumbüros, die sogenannten «Environmental Enrichment Panels». Girard liess sich von der Natur, von Landschaften und von der Volkskunst inspirieren, denen er auf ausgedehnten Reisen in Europa, Afrika, Asien und vor allem in Nord- und Südamerika begegnete. Seine Sammlung von Volkskunst aus der ganzen Welt umfasste am Schluss nahezu 100’000 Objekte. Zur Pflege und Erforschung dieser immensen Kollektion, die er auch in mehreren grossen Ausstellungen kunstvoll zu inszenieren wusste, gründete er mit seiner Frau 1961 die Girard Foundation. Der Ausstellung im Vitra Design Museum, die das Londoner Design-Studio «Raw Edges» gestaltete, gelingt es, die ganze Vielfalt von Girards gestalterischem Universum fassbar zu machen. Und der von Jochen Eisenbrand herausgegebene und konzipierte prächtige Katalog ist nichts weniger als das wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Inventar eines für die moderne Geschichte der Gebrauchskunst ebenso einzigartigen wie richtungsweisenden Lebenswerks. Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.
Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.
Kries, M., Eisenbrand, J: Alexander Girard. A Designer’s Universe. Weil am Rhein 2016 (Vitra Design Museum). 512 Seiten, € 69.90
Illustration: Daisy Face. Environmental Enrichment Panel #3036, für Herman Miller 1971, Vitra Design Museum, Nachlass Alexander Girard.

Der Katalog erschien in einer deutschen und einer englischen Ausgabe.
Kries, M., Eisenbrand, J: Alexander Girard. A Designer’s Universe. Weil am Rhein 2016 (Vitra Design Museum). 512 Seiten, € 69.90
Illustration: Daisy Face. Environmental Enrichment Panel #3036, für Herman Miller 1971, Vitra Design Museum, Nachlass Alexander Girard.
Das Museum Tinguely zeigt eine Kunstgeschichte des Tastsinns
11.02.16 15:16
Wie schon vor einem Jahr, in der Ausstellung, die sich unter dem Titel «Belle Haleine» dem Geruchssinn widmete, ist Marcel Duchamp auch beim zweiten Versuch des Museums Tinguely in Basel, künstlerische Manifestationen eines der fünf menschlichen Sinne vorzuführen, der Titelgeber. «Prière de toucher» hiess 1947 der Katalog seiner grossen Pariser Surrealisten-Präsentation, der mit einer Schaumstoff-Brust dekoriert war, und «Prière de toucher» ist jetzt der Titel der von Roland Wetzel kuratierten Schau, die in 22 Räumen rund 220 Kunstwerke von 70 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.  Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.
Der überaus abwechslungsreich angelegte Parcours hält ähnlich einer Wundertüte mehrfach Überraschungen bereit. Er beginnt und endet zum Beispiel mit zwei Filmen über die haptischen Erfahrungen von Blinden beim Berühren und «Begreifen» eines Elefanten und beim Malen mit den Händen. Thematisiert werden religiöse Berührungsrituale (Kuratorin: Eva Dietrich) ebenso wie die Darstellung des Tastsinns in allegorischen Darstellungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert (Kuratorin: Lisa Anette Ahlers). Auch wenn die Möglichkeit, Kunstwerke zu berühren, in einem Museum erwartungsgemäss beschränkt sind, erhalten die Besucher durchaus Gelegenheit, einzelne Objekte ausgiebig zu begreifen. In Zusammenarbeit mit der Skulpturhalle stehen Gipsabgüsse antiker Plastiken aus vier Jahrhunderten zum Anfassen mit verbundenen Augen bereit, um ihre Entwicklung von der schematisierten bis zur naturalistischen Darstellung zu erfahren. Selbstverständlich sind auch die aus der Kunstgeschichte der Moderne bekannten Objekte zum Thema zu sehen – von Yves Kleins «Anthropométrie sans titre» mit den Ganzkörperabdrücken von drei weiblichen Aktmodellen, die er 1960 mit seiner patentierten Farbe «International Klein Blue» bemalt hatte, bis zu Marinettis Tastrelief «Sudan-Paris» von 1920, das als praktische Anwendung seines futuristischen Manifests des Taktilismus zu verstehen ist. Insgesamt summiert sich die Schau zu einem eindrücklichen Panorama, das die Vielfalt künstlerischer Auseinandersetzung mit dem menschlichen Tastsinn mit grosser Intensität abbildet. Es ist deshalb ratsam, den Museumsbesuch als anspruchsvolles Entdeckungsabenteuer zu verstehen und sich dafür genügend Zeit zu nehmen.
An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.

An Stelle eines Katalogs erschien zur Ausstellung eine 24-seitige Broschüre als Sondernummer der «Weltkunst». Die Beiträge zu einem am 8. und 9. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung steht hier.
Jean Dubuffet in der Fondation Beyeler
28.01.16 22:30

Raphaël Bouvier (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Jean Dubuffet – Metamorphosen der Landschaft. Riehen/Ostfildern (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 232 Seiten, € 58.00/CHF 62.50.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs findet sich hier.
Illustration: Kostümierte Figur aus «Coucou Bazar». © Bild Jürg Bürgi, 2016
Maria Netter: Augenzeugin der Moderne
27.10.15 13:31

Die Publikation «Augenzeugin der Moderne 1945-1975. Maria Netter, Kunstkritikerin und Fotografin» von Bettina von Meyenburg und Rudolf Koella ist im Verlag Schwabe in Basel erschienen, 276 Seiten CHF 48.00.
Eine Besprechung des Buches folgt demnächst hier.
Illustration: Maria Netter fotografiert sich 1960 im Spiegel © Maria Netter/SIK-ISEA, Zürich/Courtesy Fotostiftung Schweiz
Ben Vautier im Museum Tinguely Basel
20.10.15 20:26
Bei seinen Landsleuten machte sich Ben Vautier (*1935) durch ein Missverständnis bekannt, als er 1992 am Eingang des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Sevilla das Schrift-Bild «La Suisse n’existe pas» anbrachte. Er wollte damit sagen, dass es DIE Schweiz, einen einheitlichen, stromlinienförmigen Schweiz-Eintopf nicht gebe, dass vielmehr die Diversität des Landes seine Existenz bestimmt. Damals, im Jahr nach dem Kulturboykott aus Anlass der mit künstlichem Patriotismus aufgeladenen 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, nahm die Öffentlichkeit Vautiers Spruch als Nestbeschmutzung wahr. Heute können wohl auch jene, die sich damals empörten, die Sache entspannter sehen und Ben Vautier als vielseitigen, ernsthaften Künstler anerkennen. Die grosse Retrospektive, die das Museum Tinguely in Basel vom 21.10.2015 bis zum 22.1.2016 dem  80-jährigen ausrichtet, bietet Gelegenheit dazu. Die von Andres Pardey und Alice Wilke kuratierte Rückschau stellt den Fokus auf die ersten 20 Jahre von Vautiers Schaffen ein und der Künstler selbst, der den zweiten Teil einrichtete, weitet ihn in über 30 Kojen bis in die Gegenwart aus. Dabei wird deutlich, dass das Werk keineswegs auf witzige und träf formulierte Schrifttafeln reduziert werden darf. Er begann mit Malereien, wobei ihn, wie in der Ausstellung unübersehbar, besonders «Bananen» faszinierten, und als er seine ersten Schriftbilder malte, war noch lange nicht klar, dass dies sein bevorzugtes Medium würde. Denn als Mitglied der «École de Nice» und als Fluxus-Pionier, trat er ab 1959 vor allem mit typischen Happenings auf, die er «gestes» nannte. Die Nähe zu den Nouveaux Réalistes, denen er nicht zugehörig war, ist unübersehbar. Kein Zufall, dass er Daniel Spoerri und Jean Tinguely neben den Freunden aus Nizza, Arman, Yves Klein und Martial Raysse besonders schätzt. Die mit über 400 Exponaten fröhlich schrankenlose Ausstellung im Museum Tinguely darf für sich in Anspruch nehmen, das Publikum in umfassender Weise mit Ben Vautiers Universum bekannt zu machen, einem Universum, in dem es ebenso um Kunst wie um Freiheit und Mut geht – drei Begriffe, die für Ben wie kommunizierende Röhren funktionieren.
80-jährigen ausrichtet, bietet Gelegenheit dazu. Die von Andres Pardey und Alice Wilke kuratierte Rückschau stellt den Fokus auf die ersten 20 Jahre von Vautiers Schaffen ein und der Künstler selbst, der den zweiten Teil einrichtete, weitet ihn in über 30 Kojen bis in die Gegenwart aus. Dabei wird deutlich, dass das Werk keineswegs auf witzige und träf formulierte Schrifttafeln reduziert werden darf. Er begann mit Malereien, wobei ihn, wie in der Ausstellung unübersehbar, besonders «Bananen» faszinierten, und als er seine ersten Schriftbilder malte, war noch lange nicht klar, dass dies sein bevorzugtes Medium würde. Denn als Mitglied der «École de Nice» und als Fluxus-Pionier, trat er ab 1959 vor allem mit typischen Happenings auf, die er «gestes» nannte. Die Nähe zu den Nouveaux Réalistes, denen er nicht zugehörig war, ist unübersehbar. Kein Zufall, dass er Daniel Spoerri und Jean Tinguely neben den Freunden aus Nizza, Arman, Yves Klein und Martial Raysse besonders schätzt. Die mit über 400 Exponaten fröhlich schrankenlose Ausstellung im Museum Tinguely darf für sich in Anspruch nehmen, das Publikum in umfassender Weise mit Ben Vautiers Universum bekannt zu machen, einem Universum, in dem es ebenso um Kunst wie um Freiheit und Mut geht – drei Begriffe, die für Ben wie kommunizierende Röhren funktionieren.
Zur Ausstellung erscheint – in deutscher und englischer Fassung – ein umfangreicher, reich illustrierter Katalog mit aktuellen Texten von Ben Vautier, Margret Schavemaker, Andres Pardey, Roland Wetzel und Alice Wilke, sowie von historischen Beiträgen verschiedener Wegbegleiter Ben Vautiers. Andres Pardey für das Museum Tinguely (Hrsg.): Ben Vautier – Ist alles Kunst? Basel (Museum Tinguely)/Heidelberg und Berlin (Kehrer Verlag) 2015. 256 Seiten, CHF 52.00
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs findet sich hier.

Zur Ausstellung erscheint – in deutscher und englischer Fassung – ein umfangreicher, reich illustrierter Katalog mit aktuellen Texten von Ben Vautier, Margret Schavemaker, Andres Pardey, Roland Wetzel und Alice Wilke, sowie von historischen Beiträgen verschiedener Wegbegleiter Ben Vautiers. Andres Pardey für das Museum Tinguely (Hrsg.): Ben Vautier – Ist alles Kunst? Basel (Museum Tinguely)/Heidelberg und Berlin (Kehrer Verlag) 2015. 256 Seiten, CHF 52.00
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs findet sich hier.
Die Russische Avantgarde in der Fondation Beyeler
02.10.15 08:52

Parallel zur «Suche nach 0,10» zeigt die Fondation Beyeler unter dem Titel «Black Sun» Werke aus der eigenen Sammlung und Leihgaben von 36 Künstlerinnen und Künstlern aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die direkt und indirekt in der Tradition von Kasimir Malewitsch stehen. So ist das ganze Haus der Fondation Beyeler bis 10. Januar 2016 ganz der russischen Avantgarde und ihrem Einfluss auf die moderne und zeitgenössische Kunst gewidmet.
Auch der umfangreiche und prächtig gestaltete Katalog unterstreicht das Gewicht, das die Fondation Beyeler ihrem einmaligen Vorhaben zuspricht. Neben Texten von ausgewiesenen Fachautoren enthält der Band wichtige, zum Teil erstmals übersetzte Dokumente zur russischen Avantgarde.
Matthew Dutt (Hrsg. für die Fondation Beyeler): Auf der Suche nach 0,10 – Die letzte futuristische Ausstellung der Malerei. Riehen/Ostfildern 2015 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag), 280 Seiten € 65.00. Der Katalog erscheint in deutscher, englischer und russischer Version.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier.
Bauhaus-Design im Vitra-Museum
25.09.15 11:22
Der trendige Titel «Das Bauhaus #allesistdesign», unter dem die Kuratorin Jolanthe Kugler ihre Retrospektive im Vitra Design Museum In Weil am Rhein affichiert, weist auf die ungebrochene Kraft der mittlerweile bald 100-jährigen Designtradition der Bauhäusler aus Weimar und Dessau hin; der Hashtag möchte zudem eine neue Debatte über die Aktualität der Bauhaus-Kultur anstossen. In der Tat sind die klaren Formen und nüchternen Linien auch für die heutigen Gestalter eine massgebende Quelle der Inspiration. Sie beeinflussen nicht nur das Aussehen von Gegenständen, vielmehr spiegeln sie auch eine bestimmte Haltung der Kreativen. So wie die Bauhaus-Studentinnen und -Studenten von ihren Meistern seinerzeit nicht nur handwerkliche und  künstlerische Grundlagen vermittelt erhielten, sondern auch ihre Rolle in der Gesellschaft reflektieren mussten, so wird auch heute von Designern nachdrücklich mehr verlangt als die Herstellung von gefälliger Warenästhetik. Die Stichworte für die Wiederbelebung der umfassenden Bauhaus-Denkart heissen «Social Design», «Open Design» oder «Design Thinking». Die Ausstellung, die das Bauhaus – vom 26.9.2015 bis 28.2.2016 in Weil am Rhein und vom 1.4. bis 14.8.2016 in der Bundeskunsthalle in Bonn – als «komplexes ‹Labor der Moderne›, das mit heutigen Designtendenzen eng verknüpft ist» (Pressetext) präsentiert, ist in vier Teile gegliedert: Der erste fokussiert auf den historischen Kontext, der zweite zeigt ikonische Objekte sowie ihre Entstehung, der dritte demonstriert an Beispielen, wie viele verschiedene Professionen an der Entstehung des «Bauhaus-Stils» beteiligt waren. Der vierte Teil befasst sich mit den kommunikativen Werkzeugen des Bauhauses (Typgrafie, Fotografie, Film), die verwendet wurden, um der Schule den eigenen, unverwechselbaren Nimbus zu geben. Wie ein erster Durchgang zeigt, erfüllt die Ausstellung die eigenen hohen Ansprüche in vollem Umfang. Neben der mit zahlreichen Leihgaben und Objekten aus der eigenen Sammlung opulent orchestrierten Schau krönt der inhaltreiche und sorgfältig gestaltete Katalog die überzeugende Leistung der Kuratorin und ihres engagierten Teams.
künstlerische Grundlagen vermittelt erhielten, sondern auch ihre Rolle in der Gesellschaft reflektieren mussten, so wird auch heute von Designern nachdrücklich mehr verlangt als die Herstellung von gefälliger Warenästhetik. Die Stichworte für die Wiederbelebung der umfassenden Bauhaus-Denkart heissen «Social Design», «Open Design» oder «Design Thinking». Die Ausstellung, die das Bauhaus – vom 26.9.2015 bis 28.2.2016 in Weil am Rhein und vom 1.4. bis 14.8.2016 in der Bundeskunsthalle in Bonn – als «komplexes ‹Labor der Moderne›, das mit heutigen Designtendenzen eng verknüpft ist» (Pressetext) präsentiert, ist in vier Teile gegliedert: Der erste fokussiert auf den historischen Kontext, der zweite zeigt ikonische Objekte sowie ihre Entstehung, der dritte demonstriert an Beispielen, wie viele verschiedene Professionen an der Entstehung des «Bauhaus-Stils» beteiligt waren. Der vierte Teil befasst sich mit den kommunikativen Werkzeugen des Bauhauses (Typgrafie, Fotografie, Film), die verwendet wurden, um der Schule den eigenen, unverwechselbaren Nimbus zu geben. Wie ein erster Durchgang zeigt, erfüllt die Ausstellung die eigenen hohen Ansprüche in vollem Umfang. Neben der mit zahlreichen Leihgaben und Objekten aus der eigenen Sammlung opulent orchestrierten Schau krönt der inhaltreiche und sorgfältig gestaltete Katalog die überzeugende Leistung der Kuratorin und ihres engagierten Teams.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
Kries, M., Kugler, J.: Das Bauhaus #allesistdesign, Weil am Rhein 2015 (Vitra Design Museum) 464 Seiten, € 69.90. (Englische Ausgabe: The Bauhaus #itsalldesign).

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu finden.
Kries, M., Kugler, J.: Das Bauhaus #allesistdesign, Weil am Rhein 2015 (Vitra Design Museum) 464 Seiten, € 69.90. (Englische Ausgabe: The Bauhaus #itsalldesign).
Haroon Mirza/hrm199 Ltd. im Museum Tinguely
09.06.15 15:11

Zur Ausstellung erschien ein Katalog, der das prozesshafte Kunstverständnis von Haroon Mirza und seiner «hrm199 Ltd.» perfekt widerspiegelt. Er bietet gleichzeitig ein Werkverzeichnis und eine Beschreibung des Entstehens der aktuellen Ausstellung. Roland Wetzel, Sandra Beate Reimann (Hrsg.): Haroon Mirza/hrm199 Ltd. Basel/Köln 2015 (Museum Tinguely/Snoeck Verlagsgesellschaft mbH), 408 Seiten, CHF 48.00 (Museumspreis),
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs befindet sich hier.
Illustration: © La Nouvelle République, 18.7.2013
Marlene Dumas – Das Bild als Bürde
29.05.15 15:51

Leontine Coelewji, Helen Sainsbury, Theodora Vischer (Hrsg.): Marlene Dumas – The Image as Burden. Riehen/Basel und Ostfildern (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag). 196 Seiten, €38.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und eine Würdigung des Katalogs sind hier zu finden.
Vitra Design Museum: Design in Afrika
13.03.15 16:06

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Paul Gauguin in der Fondation Beyeler
11.02.15 13:52

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des sehr schön gestalteten Katalogs und der darin enthaltenen Aufsätze steht hier.
Duft der Kunst im Museum Tinguely
10.02.15 08:47
36 Künstlerinnen und Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts und ein halbes Dutzend Kollegen aus der Zeit des Barock schufen das Material, das vom 11. Februar bis zum 17. Mai 2015 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «Belle Haleine», den «Duft der Kunst» verbreitet. Es sei die erste Ausstellung einer geplanten Reihe über die menschlichen Sinne, erklärte Museumsdirektor Roland Wetzel in seiner Einführung. Und der Start ist, wie ein erster Rundgang zeigt, trotz der Schwierigkeit, olfaktorische Reize und visuelle Effekte zu Kunstwerken zu vereinen, fulminant gelungen. Dies ist wohl in erster Linie dem Mut der Kuratorin Annja Müller-Alsbach zu verdanken, die Schau nicht künstlich einem Oberthema unterzuordnen, sondern die Kunstwerke lediglich  lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.
lose zu gruppieren. So gibt es eine Werkgruppe, die dem menschlichen Körper und seinen Ausdünstungen gewidmet ist, eine andere befasst sich mit der Kommerzialisierung der Düfte und eine dritte mit den Gerüchen der Natur. Die Fülle der Variationen ist überwältigend überraschend. Sie beginnt mit Duftbildern aus dem Barock, demonstriert an Beispielen – Duchamps Glasphiole mit «Air de Paris» oder Jean Tinguelys mit Abgas- und Maiglöckchenduft gefüllter Ballon, den er 1959 auf der ersten Pariser Biennale zum Getöse seiner «Méta-Matic Nr. 17» platzen liess – die lange Tradition olfaktorischer Kreativität. Wie man mit Düften manipulatorisch wirkt, zeigt etwa die gemeinsam von Carsten Höller und François Roche erfundene «Hypothèse de grue» – ein Spiel mit dem Wortfeld zwischen Kran und Schnepfe (Dirne): Eine Nebelmaschine stösst den Sexuallockstoff Pheromon aus und dazu weitere nicht deklarierte Neurostimulanzien und macht die ahnungslosen Betrachtenden zu Versuchskaninchen. Wie sich im Bereich der Gerüche Kunst und Wissenschaft, Inspiration und Rationalität verbinden, ist sehr eindrücklich in der Arbeit «The Fear of Smell – the Smell of Fear» der norwegischen Künstlerin Sessel Tolaas zu sehen. Die Arbeit basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, welche die Ausdünstungen von Phobikern erforschte. Die Duftmoleküle wurden analysiert und anschliessend synthetisiert und mikroinkapsuliert, sodass die Künstlerin damit die Wände imprägnieren konnte, und die Betrachtenden nun da und dort eine Nase voll nehmen können.
Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.

Zur Ausstellung erschien an Stelle eines Katalogs eine 24-seitige Broschüre. Die Beiträge zu einem am 17. und 18. April geplanten Symposium werden später in einer separaten Publikation erscheinen.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung ist hier zu finden.
Poesie der Grossstadt: Die Affichistes im Museum Tinguely
21.10.14 19:52

Sie gehörten zu den innovativsten, von neuen Ideen strotzenden Künstlern in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie waren dabei, als der Kunstkritiker und grosse Anreger Pierre Restany (1930–2003) am 27. Oktober 1960 in der Wohnung von Yves Klein (1928-1962) sein Manifest eines «Nouveau Réalisme» vorlegte, um sie – darunter auch Arman, Martial Raysse, Jean Tinguely und Daniel Spoerri – zu einer Künstlergruppe zu formen. Und gleichwohl sind ihre Namen hierzulande (und auch in Deutschland) kaum bekannt: François Dufrêne (1930–1982), Raymond Hains (1926–2005) und Jacques Villeglé (geb. 1926). Später kamen noch der Italiener Mimmo Rotella und der Deutsche Wolf Vostell dazu. Unter dem Titel «Poesie der Grossstadt – Die Affichisten» ermöglicht das Museum Tinguely in Basel einen umfassenden Einblick in das Schaffen dieser Anti-Maler, die als eine Art Stadtindianer von der Sonne gebleichte, vom Regen aufgeweichte und von Vandalen verunstaltete Plakate von Mauern und Zäunen rissen, um sie als urbane Zeitzeugnisse zu bearbeiten und auszustellen. Die von Roland Wetzel, Direktor des Museums Tinguely in Basel, und Esther Schlicht, Kuratorin und Ausstellungsleiterin der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main, gemeinsam konzipierte Schau gibt vom 22. Oktober 2014 bis 17. Januar 2015 in Basel (und danach in Frankfurt) einen umfassenden Einblick in das künstlerische Universum dieser ausgeprägten Individualisten, die sich zum Ziel setzten, gemeinsam den Kunstbetrieb auf eine höhere, alle möglichen Ausdrucksformen verbindende Stufe zu heben. Die Décollage, das Abreissen und weiter bearbeiten des städtischen Plakatmülls, war nur eine ihrer Methoden. Sie experimentierten, allein oder in Gruppen, mit Auftritten als Poeten, welche – ähnlich wie seinerzeit die Dadaisten – die Grenzen des sprachlichen Ausdrucks erforschten, oder sie widmeten sich mit grösstem Enthusiasmus dem Film und der Fotografie. Mit grossem Geschick führen die Ausstellungsmacher die Besucher durch Themen und Räume und zeigen die ungeheure Vielfalt der affichistischen Formen – von der kleinformatigen, etüdenhaften Dekonstruktion bis zum grossformatigen, marktschreierischen Auftritt. In allen Fällen überzeugt die bildnerische Präsenz der zwischen 1946 und 1968 entstandenen Werke. Es ist dem Museum Tinguely (und später der Schirn Kunsthalle) hoch anzurechnen, dass sie sich auf dieses anspruchsvolle Projekt, das sich ganz auf die Präsentation einer ausserhalb Frankreichs in Vergessenheit geratenen Kunstrichtung konzentriert, eingelassen haben.
Ein sorgfältig gestalteter, opulent bebilderter grossformatiger Katalog mit kenntnisreichen Essays von Bernard Blistène, Fritz Emslander, Esther Schlicht, Didier Semin, Dominique Stella und einem Interview von Roland Wetzel mit dem letzten lebenden Affichisten Jacques Villeglé und einem ausführlichen Dokumentarteil unterstreicht den Anspruch, die grossstädtische Poesie der Affichisten zu vergegenwärtigen. Die Publikation ist bei der Snoeck Verlagsgesellschaft mbH Köln erschienen. 280 Seiten, CHF 42.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs folgt demnächst hier.
Alvar Aalto: Natürliche Formen
08.10.14 09:10
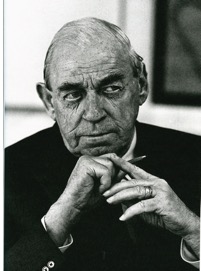
Zur Orientierung in diesem fast unübersehbaren Lebenswerk ist das Katalogbuch sehr hilfreich. Es dokumentiert nicht nur die Exponate und die eigens für die Schau vom Fotokünstlers Armin Linke hergestellten Bildfolgen, sondern enthält eine Fülle weiterer Dokumente und ein gutes Dutzend sachkundiger Essays zu allen Aspekten von Aaltos Wirken. Jochen Eisenbrand, Mateo Kries (Hrsg.): Alvar Aalto – Second Nature. Weil am Rhein 2014 (Vitra Design Museum), 688 Seiten, € 69.90)
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier zur Verfügung.
Gustave Courbet: Erster Avantgardist
06.09.14 21:07
Vom 7. September 2014 bis 18. Januar 2015 präsentiert Kurator Ulf Küster den französischen Maler Gustave Courbet (1819 bis 1877) in der Fondation Beyeler in Riehen als Vorvater der Moderne. Thematisch geordnet hängen 57 Gemälde des autodidaktisch geschulten Künstlers in acht Sälen. Zuerst fällt auf, dass die Bilder nicht, wie zu erwarten wäre, auf farbigen Wänden gezeigt werden, sondern – ganz bewusst – auf weissem Hintergrund. Der Ausstellungsmacher entschied sich nach eingehenden Farbstudien für diese Lösung, um zu betonen, dass der aus dem französischen Jura, aus Ornans in der Franche-Comté stammende Künstler «als erster Avantgardist der Kunstgeschichte» mit den Kollegen der klassischen Moderne eng verbunden ist. Der Sohn eines reichen Grundbesitzers musste sich nie um die akademischen Traditionen seines Metiers kümmern. Er musste sich niemandem anbiedern, niemandem gefallen. Er hatte den Ehrgeiz (und wie sich zeigte auch die Fähigkeit) ganz auf sich selbst gestellt ein grosser Maler zu werden. Er studierte selbstständig die künstlerischen Traditionen, die Motive und die Techniken – um sie nach und nach hinter sich zulassen. Als junger Künstler in Paris sass er zwar fleissig im Louvre und kopierte berühmte Gemälde, doch Sicherheit erarbeitete er sich an einer langen Reihe von Selbstporträts in verschiedenen Posen. Bei diesen Arbeiten – und später in Landschaftsbildern mit Motiven aus seiner engeren Heimat – erfand er seine ganz eigene Maltechnik. Er spachtelte die Farbe mit dem Palettmesser auf die Leinwand, er nahm einen Lappen oder den Daumen zu Hilfe, um ganz eigene Effekte zu erzeugen. Seine romantisch-realistischen Natur- und Menschendarstellungen erlangen durch die radikale Farbanwendung eine eigene Qualität. Schon seine Zeitgenossen bewunderten seine Eigenständigkeit, und er erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Seine Bilder fanden reissenden Absatz. Er arbeitete wie besessen – «ein Tag, ein Bild» oder «eine Stunde, ein Bild», brüstete er sich gelegentlich – um der Nachfrage nachzukommen. Ein Modemaler war er gleichwohl nie. Viele seiner Motive waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts reine Provokationen, nicht zuletzt die erotisch aufgeladenen Frauenakte, die in seinem sagenhaften Unterleibs-Torso «L’Origine du monde» gipfelten, der erst ab 1995 öffentlich gezeigt wurde. Auch seine politischen Ansichten waren notorisch provokativ. Er weigerte sich den Orden der Ehrenlegion anzunehmen, und er liess sich 1870 von der Pariser Kommune zum Kunstkommissar ernennen. Als die Revolution scheiterte, verlor er nicht nur das Regierungsamt, sondern auch seine Reputation. Die neue Obrigkeit warf ihm vor, er habe die Schleifung der Vendôme-Säule persönlich zu verantworten. Nach Gefängnisstrafe, Plünderung seines Ateliers und Verurteilung zu den horrenden Kosten des Wiederaufbaus des Denkmals floh Courbet 1873 bei Nacht und Nebel in die Schweiz. In seiner Heimat geächtet, wirkte er – weiter revolutionär gestimmt und unermüdlich schaffend, aber depressiv und dem Alkohol verfallen – in seinen letzten Jahren in der kleinen Schweizer Kunstszene als Inspirator. Just als er die erste Tranche seiner Abzahlung zusammen hatte, starb Gustave Courbet 1877 in La-Tour-de-Peilz über dem Genfersee mit 58 an der Schrumpfleber.
Der Sohn eines reichen Grundbesitzers musste sich nie um die akademischen Traditionen seines Metiers kümmern. Er musste sich niemandem anbiedern, niemandem gefallen. Er hatte den Ehrgeiz (und wie sich zeigte auch die Fähigkeit) ganz auf sich selbst gestellt ein grosser Maler zu werden. Er studierte selbstständig die künstlerischen Traditionen, die Motive und die Techniken – um sie nach und nach hinter sich zulassen. Als junger Künstler in Paris sass er zwar fleissig im Louvre und kopierte berühmte Gemälde, doch Sicherheit erarbeitete er sich an einer langen Reihe von Selbstporträts in verschiedenen Posen. Bei diesen Arbeiten – und später in Landschaftsbildern mit Motiven aus seiner engeren Heimat – erfand er seine ganz eigene Maltechnik. Er spachtelte die Farbe mit dem Palettmesser auf die Leinwand, er nahm einen Lappen oder den Daumen zu Hilfe, um ganz eigene Effekte zu erzeugen. Seine romantisch-realistischen Natur- und Menschendarstellungen erlangen durch die radikale Farbanwendung eine eigene Qualität. Schon seine Zeitgenossen bewunderten seine Eigenständigkeit, und er erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Seine Bilder fanden reissenden Absatz. Er arbeitete wie besessen – «ein Tag, ein Bild» oder «eine Stunde, ein Bild», brüstete er sich gelegentlich – um der Nachfrage nachzukommen. Ein Modemaler war er gleichwohl nie. Viele seiner Motive waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts reine Provokationen, nicht zuletzt die erotisch aufgeladenen Frauenakte, die in seinem sagenhaften Unterleibs-Torso «L’Origine du monde» gipfelten, der erst ab 1995 öffentlich gezeigt wurde. Auch seine politischen Ansichten waren notorisch provokativ. Er weigerte sich den Orden der Ehrenlegion anzunehmen, und er liess sich 1870 von der Pariser Kommune zum Kunstkommissar ernennen. Als die Revolution scheiterte, verlor er nicht nur das Regierungsamt, sondern auch seine Reputation. Die neue Obrigkeit warf ihm vor, er habe die Schleifung der Vendôme-Säule persönlich zu verantworten. Nach Gefängnisstrafe, Plünderung seines Ateliers und Verurteilung zu den horrenden Kosten des Wiederaufbaus des Denkmals floh Courbet 1873 bei Nacht und Nebel in die Schweiz. In seiner Heimat geächtet, wirkte er – weiter revolutionär gestimmt und unermüdlich schaffend, aber depressiv und dem Alkohol verfallen – in seinen letzten Jahren in der kleinen Schweizer Kunstszene als Inspirator. Just als er die erste Tranche seiner Abzahlung zusammen hatte, starb Gustave Courbet 1877 in La-Tour-de-Peilz über dem Genfersee mit 58 an der Schrumpfleber.
(Während sich die Ausstellung in der Fondation Beyeler Courbets Aufstieg zum Praeceptor pictorum («Ich bin ein Epochenwechsel») dokumentiert, zeigt gleichzeitig das Musée d’Art et d’Histoire in Genf vom 5.9.2014 bis 4.1.2015 das Schaffen Courbets in den Jahren des Schweizer Exils.)
Der Katalog – in deutscher und englischer Version erhältlich – übernimmt die thematische Gliederung der Ausstellung in der Fondation Beyeler und vertieft die informativen Saaltexte durch kenntnisreiche Aufsätze des Kurators und weiterer Courbet-Kenner. Ulf Küster (Hrsg.): Gustave Courbet. Riehen/Ostfildern 2014 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 200 Seiten. CHF 62.50
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier

(Während sich die Ausstellung in der Fondation Beyeler Courbets Aufstieg zum Praeceptor pictorum («Ich bin ein Epochenwechsel») dokumentiert, zeigt gleichzeitig das Musée d’Art et d’Histoire in Genf vom 5.9.2014 bis 4.1.2015 das Schaffen Courbets in den Jahren des Schweizer Exils.)
Der Katalog – in deutscher und englischer Version erhältlich – übernimmt die thematische Gliederung der Ausstellung in der Fondation Beyeler und vertieft die informativen Saaltexte durch kenntnisreiche Aufsätze des Kurators und weiterer Courbet-Kenner. Ulf Küster (Hrsg.): Gustave Courbet. Riehen/Ostfildern 2014 (Fondation Beyeler/Hatje Cantz Verlag) 200 Seiten. CHF 62.50
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier
Ilya Kabakov im Kunsthaus Zug
21.07.14 15:05
Unter dem Titel «Ich beginne zu vergessen» zeigt das Kunsthaus Zug bis zum 17. August 2014 Gemälde, Zeichnungen, Schriftstücke und eine Installation des russischen Künstlers Ilya Kabakov, die zum grössten Teil aus Schweizer Privatsammlungen stammen. Ergänzt wird die Schau durch Arbeiten auf Papier von Vertretern der russischen Avantgarde aus zwei Zuger Privatsammlungen.
Mit der Schweiz ist der Moskauer Avantgardist besonders eng verbunden, seit ihm die Berner Kunsthalle 1985 seine erste Einzelausstellung diesseits des Eisernen Vorhangs ausrichtete. Da er keine Ausfuhrgenehmigung für seine Werke erhielt, musste damals jedes einzeln an zuverlässige Adressaten verschickt werden, die es dann nach Bern weiter spedierten. Auch der Künstler selbst erhielt keine Reisegenehmigung. Indem er er zur Zeit der Vernissage in einem Wald bei Moskau ein Band durchschnitt, machte sich der damals 52-jährige symbolisch zum international beachteten Maler. Es war unter anderen Kunsthalle-Präsident (und bis 1984 Staatssekretär) Paul R. Jolles (1919 - 2000), der ihm weitere Kontakte zu Sammlern und Förderern verschaffte, nachdem Kabakov und seine Frau Emilia 1986 die Sowjetunion verlassen konnten.
Die aktuelle, von Matthias Haldemann zusammen mit dem Künstlerpaar eingerichtete Ausstellung im Kunsthaus Zug ist zweigeteilt. Sie zeigt Arbeiten aus den frühen Jahren, in denen sich Kabakov mit ironischer Distanz den Widerwärtigkeiten des sowjetischen Alltags widmet, und den Zyklus von Gemälden aus dem Jahr 2010, die sich collage-artig mit Erinnerungsfetzen aus der Zeit des sozialistischen Realismus und der Sowjetpropaganda befasst.
 Auf den Gemälden des zehnteiligen Zyklus «Collage of Spaces» aus dem Jahr 2010 collagiert Kabakov raffiniert aus dem Alltag gezupfte Szenen mit sowjetischer Propgandamalerei zum Lob der Werktätigen in der Stadt und auf dem Land. Da werden zwar Geschichten angedeutet, aber sie sind eben aus dem Zusammenhang gerissen.
Auf den Gemälden des zehnteiligen Zyklus «Collage of Spaces» aus dem Jahr 2010 collagiert Kabakov raffiniert aus dem Alltag gezupfte Szenen mit sowjetischer Propgandamalerei zum Lob der Werktätigen in der Stadt und auf dem Land. Da werden zwar Geschichten angedeutet, aber sie sind eben aus dem Zusammenhang gerissen.
Der Titel «Ich beginne zu vergessen» ist demnach offensichtlich paradox gemeint: Kabakov hängt an seinen Erinnerungen – nicht nur an die Unfreiheit, an die lächerlichen Repressionen, sondern auch an seine Familie, an die Mutter, an die Tanten – und malt, um sie in der Gegenwart lebendig zu erhalten. Während in den älteren Arbeiten geschriebene Worte und Dialogfetzen eine wichtige Rolle spielen, kommen die neuen Werke ohne Kommentare aus.
Die Reminiszenzen beginnen mit Bildern aus der Zeit der Gemeinschaftswohnungen. Da hängt zum Beispiel ein Flaschenreiniger an der schmutzig-grünen Wand der Küche. Und am oberen linken Bildrand stellt eine Anna Prochorowna Sobina die Frage «Wem gehört, dieses Bürstchen?» Und Boris Michailowitsch Polesin antwortet: «Anna Prochorowna».
 Auf einem anderen Grossformat ist – offensichtlich zu Händen einer anonymen Hausverwaltung (und damit der Staatssicherheit) – aufgelistet, wer am Sonntagabend zu Besuch weilte: Name, von…bis. Was normalerweise routinemässig auf einen Zettel geschrieben wurde, wird uns hier als monumentales Zeugnis der Unfreiheit entgegen gehalten.
Auf einem anderen Grossformat ist – offensichtlich zu Händen einer anonymen Hausverwaltung (und damit der Staatssicherheit) – aufgelistet, wer am Sonntagabend zu Besuch weilte: Name, von…bis. Was normalerweise routinemässig auf einen Zettel geschrieben wurde, wird uns hier als monumentales Zeugnis der Unfreiheit entgegen gehalten.
Da Ausstellungen der Avantgarde zu den bleiernen Sowjetzeiten nicht in Frage kamen, erfand Ilya Kabakov in seinem, in der hintersten Ecke eines vergammelten Dachbodens einer Moskauer Mietskaserne eingerichteten Atelier die Form der Alben. Die handlichen Leporellos konnte er zu den Treffen der Kollegen mitnehmen und sie herumzeigen. Der Austausch in Künstlerkreisen war allerdings nicht so rege, wie wir Wehster uns das vorstellen. Zeitzeugen berichten bedauernd von Einzelgängern, die sich verbissen ihren eigenen Projekten widmeten und die Arbeiten anderer zur Kenntnis nahmen, ohne sich auf kritische Auseinandersetzungen einzulassen.
 Um sich künstlerisch mit dem Erbe der russischen Avantgarde der Revolutions- und Nachrevolutionszeit zu befassen, erfand Kabakov nach seiner Emigration als sein Alter Ego die Maler-Figur des Charles Rosenthal, der in seinen Werken versucht, eine Brücke zwischen den Modernisten und dem sozialistischen Realismus zu schlagen, weil er sich angeblich nicht für eines der beiden Konzepte entscheiden. Deshalb gibt es auf seinen Bildern immer beides: eine realistische Szene und ein Stück reiner suprematistischer Malerei. Die Konfrontation pflegt er durch eine grosszügig bemessene weisse Fläche zu mildern.
Um sich künstlerisch mit dem Erbe der russischen Avantgarde der Revolutions- und Nachrevolutionszeit zu befassen, erfand Kabakov nach seiner Emigration als sein Alter Ego die Maler-Figur des Charles Rosenthal, der in seinen Werken versucht, eine Brücke zwischen den Modernisten und dem sozialistischen Realismus zu schlagen, weil er sich angeblich nicht für eines der beiden Konzepte entscheiden. Deshalb gibt es auf seinen Bildern immer beides: eine realistische Szene und ein Stück reiner suprematistischer Malerei. Die Konfrontation pflegt er durch eine grosszügig bemessene weisse Fläche zu mildern.
Die Ausstellung in Zug zeigt Kabakovs malerische Anfänge und dokumentiert seine Rückkehr zur Malerei in jüngster Zeit. Konzeptuelle und skulpturale Arbeiten, die ihn als Erfinder eines eigenen utopischen Kosmos bekannt machten, der sich sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft inspirieren lässt, fehlen – bis auf das Frühwerk «Konzert für eine Fliege» – ganz. Das muss man wissen, um keine falschen Erwartungen zu hegen. (Wer Kabakovs jüngste Konzept-Kunst kennenlernen wollte, hätte bis zum 22. Juni nach Paris reisen müssen, wo im Grand Palais an der Monumenta 2014 auf 30’000 Quadratmeter die Utopie «L’ Etrange Cité» zu sehen war.)
Kabakov, schreibt der Zuger Ausstellungsmacher Matthias Haldemann, gilt zwar als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, zumal seine Werke die Brücke zwischen der inoffiziellen Kunst der Sowjetzeit und der Avantgarde des Westens bilden: «Trotzdem wird Ilya Kabakov unterschätzt. In seinen fantasievollen Arbeiten betrachtet er die moderne Zivilisation ohne ideologische Schranken. In ihrer erzählenden Haltung sind die Bilder zugänglich, obwohl sie stets die Frage in sich tragen: Wer hat hier für wen gemalt und weshalb?»
Illustrationen: «Collage of Spaces #10» (Collection Valentin Bukthoyarov © 2014, ProLitteris, Zurich), »Wem gehört das Bürstchen?» (© Pro Litteris 2014), «Charles Rosenthal: Zwölf Ergänzungen zur Theorie des Suprematismus # 2 1926, Kanal» (Privatsammlung Schweiz).
Mit der Schweiz ist der Moskauer Avantgardist besonders eng verbunden, seit ihm die Berner Kunsthalle 1985 seine erste Einzelausstellung diesseits des Eisernen Vorhangs ausrichtete. Da er keine Ausfuhrgenehmigung für seine Werke erhielt, musste damals jedes einzeln an zuverlässige Adressaten verschickt werden, die es dann nach Bern weiter spedierten. Auch der Künstler selbst erhielt keine Reisegenehmigung. Indem er er zur Zeit der Vernissage in einem Wald bei Moskau ein Band durchschnitt, machte sich der damals 52-jährige symbolisch zum international beachteten Maler. Es war unter anderen Kunsthalle-Präsident (und bis 1984 Staatssekretär) Paul R. Jolles (1919 - 2000), der ihm weitere Kontakte zu Sammlern und Förderern verschaffte, nachdem Kabakov und seine Frau Emilia 1986 die Sowjetunion verlassen konnten.
Die aktuelle, von Matthias Haldemann zusammen mit dem Künstlerpaar eingerichtete Ausstellung im Kunsthaus Zug ist zweigeteilt. Sie zeigt Arbeiten aus den frühen Jahren, in denen sich Kabakov mit ironischer Distanz den Widerwärtigkeiten des sowjetischen Alltags widmet, und den Zyklus von Gemälden aus dem Jahr 2010, die sich collage-artig mit Erinnerungsfetzen aus der Zeit des sozialistischen Realismus und der Sowjetpropaganda befasst.

Der Titel «Ich beginne zu vergessen» ist demnach offensichtlich paradox gemeint: Kabakov hängt an seinen Erinnerungen – nicht nur an die Unfreiheit, an die lächerlichen Repressionen, sondern auch an seine Familie, an die Mutter, an die Tanten – und malt, um sie in der Gegenwart lebendig zu erhalten. Während in den älteren Arbeiten geschriebene Worte und Dialogfetzen eine wichtige Rolle spielen, kommen die neuen Werke ohne Kommentare aus.
Die Reminiszenzen beginnen mit Bildern aus der Zeit der Gemeinschaftswohnungen. Da hängt zum Beispiel ein Flaschenreiniger an der schmutzig-grünen Wand der Küche. Und am oberen linken Bildrand stellt eine Anna Prochorowna Sobina die Frage «Wem gehört, dieses Bürstchen?» Und Boris Michailowitsch Polesin antwortet: «Anna Prochorowna».

Da Ausstellungen der Avantgarde zu den bleiernen Sowjetzeiten nicht in Frage kamen, erfand Ilya Kabakov in seinem, in der hintersten Ecke eines vergammelten Dachbodens einer Moskauer Mietskaserne eingerichteten Atelier die Form der Alben. Die handlichen Leporellos konnte er zu den Treffen der Kollegen mitnehmen und sie herumzeigen. Der Austausch in Künstlerkreisen war allerdings nicht so rege, wie wir Wehster uns das vorstellen. Zeitzeugen berichten bedauernd von Einzelgängern, die sich verbissen ihren eigenen Projekten widmeten und die Arbeiten anderer zur Kenntnis nahmen, ohne sich auf kritische Auseinandersetzungen einzulassen.

Die Ausstellung in Zug zeigt Kabakovs malerische Anfänge und dokumentiert seine Rückkehr zur Malerei in jüngster Zeit. Konzeptuelle und skulpturale Arbeiten, die ihn als Erfinder eines eigenen utopischen Kosmos bekannt machten, der sich sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft inspirieren lässt, fehlen – bis auf das Frühwerk «Konzert für eine Fliege» – ganz. Das muss man wissen, um keine falschen Erwartungen zu hegen. (Wer Kabakovs jüngste Konzept-Kunst kennenlernen wollte, hätte bis zum 22. Juni nach Paris reisen müssen, wo im Grand Palais an der Monumenta 2014 auf 30’000 Quadratmeter die Utopie «L’ Etrange Cité» zu sehen war.)
Kabakov, schreibt der Zuger Ausstellungsmacher Matthias Haldemann, gilt zwar als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, zumal seine Werke die Brücke zwischen der inoffiziellen Kunst der Sowjetzeit und der Avantgarde des Westens bilden: «Trotzdem wird Ilya Kabakov unterschätzt. In seinen fantasievollen Arbeiten betrachtet er die moderne Zivilisation ohne ideologische Schranken. In ihrer erzählenden Haltung sind die Bilder zugänglich, obwohl sie stets die Frage in sich tragen: Wer hat hier für wen gemalt und weshalb?»
Illustrationen: «Collage of Spaces #10» (Collection Valentin Bukthoyarov © 2014, ProLitteris, Zurich), »Wem gehört das Bürstchen?» (© Pro Litteris 2014), «Charles Rosenthal: Zwölf Ergänzungen zur Theorie des Suprematismus # 2 1926, Kanal» (Privatsammlung Schweiz).
Krištof Kintera: I AM NOT YOU
10.06.14 09:28

Zur Ausstellung erscheint ein «Katalog» in Einzelblättern mit Dokumenten und Fotos aus der Werkstatt des Künstlers sowie einem Gespräch zwischen Krištof Kintera, Roland Wetzel, Andres Pardey und dem Galeristen Jiří Švestka in englischer Sprache. Jedes Exemplar ist in einer individuellen Schuhschachtel handverpackt. Ausschliesslich erhältlich im Museumsshop: CHF 68.00
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des «Katalogs» steht hier.
Iluustration: A Prayer for Loss of Arrogance, 2013.
Gerhard Richter: Serien, Zyklen, Räume
14.05.14 08:44

Konstantin Grcic: Design als Abenteuer
22.03.14 11:16

Spielobjekte im Museum Tinguely
18.02.14 14:08
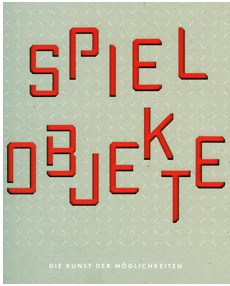
Der Katalog enthält Texte von Annja Müller-Alsbach, Frederik Schikowski, Roland Wetzel und Interviews mit den Kunstschaffenden Mary Bauermeister, Peter Lindbergh, Grazia Varisco sowie – in separaten Bänden – Abbildungen aller ausgestellten Werke und eine «Anthologie» mit zusätzlichem Text- und Bildmaterial zum Thema. Museum Tinguely (Hrsg.): Spielobjekte – Die Kunst der Möglichkeiten. Basel/Köln 2014 (Kehrer Verlag), 208 Seiten, CHF 48.00 (im Museumsshop)
Odilon Redon in der Fondation Beyeler
30.01.14 17:23

Illustration: Odilon Redon, 1894 (© Bridgeman Art Library)
Lichtdesign im Vitra Design Museum
20.11.13 15:37

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Illustration Pieke Bergmans «Totally in Love» 2012. Foto @Jürg Bürgi 2013.
Thomas Schütte in der Fondation Beyeler
13.11.13 16:26

Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich die Skulpturen mit ihrer Umgebung kommunizieren. Die einfarbig schwarze Riesen-Version der Gruppe «United Enemies» ist ein gutes Beispiel dafür. Eigentlich für den Aussenraum gedacht, wird sie hier erstmals in vier Wänden gezeigt – und wirkt auf die Besucher in der Eingangshalle mit ihrer massiven, verbissenen Präsenz prompt bedrohlich. Viel eindrücklicher und witziger erscheint dagegen die kleinformatige, farbige, puppenhafte Frühversion desselben Motivs, das 1992 in Rom entstand. Dasselbe gilt für die Alien-artige Gruppe «Vier Grosse Geister» aus schwarz patinierter Bronze, die vor der Ausstellung auf öffentliche Plätze nach Zürich, Genf und Bern geschickt worden war. Als problematisch erweist sich auch die Massierung der nummerierten Stahl-, Bronze- und Aluminiumfrauen im grossen, gegen Norden ausgerichteten Gartensaal. Sie führt dazu, dass die Werke gar nicht mehr als individuell gestaltete Einzelstücke sondern nur als Ensemble im Depot einer Galerie, oder – freundlicher formuliert – in einem Schaulager wahrgenommen werden, wo sie auf Abnehmer warten. (Im Essener Folkwang-Museum sind vom 21.9.2013 bis 12.1.2014 ebenfalls Abgüsse der «Frauen» zu sehen; allerdings wird ihnen dort deutlich mehr Raum gegeben.) Auch diese Frauen-Skulpturen, ist aufgrund der zur Verfügung gestellten Pressebilder zu vermuten, könnten im Freien und als Solitäre gezeigt werden.

Wie ein Kontrastprogramm zu den wuchtigen, raumfüllenden Plastiken präsentieren sich die Zeichnungen und Aquarelle. Es handelt sich dabei um unabhängige Werkzyklen mit einer eigenen subtilen Formensprache.
Alles in allem bietet die Ausstellung in der Fondation Beyeler einen guten Überblick über das skulpturale Werk Thomas Schüttes. Wer den Düsseldorfer auch als Konzept-Künstler erleben will, hat im Kunstmuseum Luzern Gelegenheit dazu.
Der Katalog zur Ausstellung «Thomas Schütte FIGUR» präsentiert 252 Abbildungen, einen Aufsatz von Adrian Searle, sowie Interviews von Theodora Vischer mit Thomas Schütte, sowie ein Gespräch zwischen Gerhard Richter, Thomas Schütte und Theodora Vischer. Köln 2013 (Walther König Verlag), 193 Seiten, CHF 59.00
Illustrationen: «Die Fremden» (1992), «Vater Staat» (2010)
© Text und Bilder Jürg Bürgi, 2013
Zehn Künstler und Tinguelys Geist
22.10.13 17:54
Als Jean Tinguely 1955 seine erste Zeichenmaschine baute, war er 30 Jahre alt. Die elf Künstlerinnen und Künstler, die 2009 auf eine Ausschreibung der Amsterdamer «Métamatic Research Initiative» (MRI) antworteten, sich aus heutiger Sicht mit Jean Tinguelys «Méta-Matics» zu beschäftigen, sind um einiges älter als der junge Basler damals und auch um einiges erfahrener. Die Beiträge, die Maria Abramović, Ranjit Bhatnagar, John Bock, Olaf Breuning, Thomas Hirschhorn, Aleksandra Hirszfeld, Jon Kessler, das Künstlerpaar Aparna Rao und Søren Pors, João Simões sowie Brigitte Zieger vom 23. Oktober 2013 bis 26. Januar 2014 im Museum Tinguely in Basel unter dem Titel «METAMATIC Reloaded» (Kuratoren Andres Pardey und Siebe Tettero) zeigen, nehmen in unterschiedlicher Weise Bezug auf den Ansatz Tinguelys, Maschinen unter tätiger Mithilfe des Publikums Kunst produzieren zu lassen. Vier – allen voran die Performance-Meisterin Abramović, aber auch Ranjit Bhatnagar,  Jon Kessler sowie Aleksandra Hirszfeld – setzen auf die aktive Mitwirkung der Ausstellungsbesucher. Aber auch die Arbeiten der andern zielen darauf, die Betrachtenden einzubeziehen – sei es, dass sie das Geschehen beeinflussen, sei es, dass sie durch ihre Anwesenheit eine Installation erst vollständig machen, wie in Thomas Hirschhorns begehbarem «Diachronic-Pool». Andere spielen mit Zufälligkeiten und lassen aus raffinierten technischen Installationen Neues, Unerwartetes entstehen. Ein erster Durchgang durch die Schau ergibt den Eindruck grosser Diversität. Angesichts der heute jederzeit verfügbaren technischen Mittel ist das allerdings nicht überraschend. Es ist müssig zu behaupten, Tinguely und die andern Teilnehmenden der sagenhaften Präsentation «Le Mouvement» in der Galerie Denise René von 1955 seien die «echteren» Innovatoren gewesen. Denn damals war es bedeutend einfacher, das Publikum zu überraschen als heute, wo scheinbar alles möglich und alles schon dagewesen ist. Am meisten verblüfft hat uns Brigitte Zieglers «Shooting Wallpaper», eine biedermeierliche Tapeten-Projektion, die plötzlich lebendig wird. Mehr darüber und über alle andern Werke in einer ausführlichen Besprechung der Ausstellung und des Katalogs hier.
Jon Kessler sowie Aleksandra Hirszfeld – setzen auf die aktive Mitwirkung der Ausstellungsbesucher. Aber auch die Arbeiten der andern zielen darauf, die Betrachtenden einzubeziehen – sei es, dass sie das Geschehen beeinflussen, sei es, dass sie durch ihre Anwesenheit eine Installation erst vollständig machen, wie in Thomas Hirschhorns begehbarem «Diachronic-Pool». Andere spielen mit Zufälligkeiten und lassen aus raffinierten technischen Installationen Neues, Unerwartetes entstehen. Ein erster Durchgang durch die Schau ergibt den Eindruck grosser Diversität. Angesichts der heute jederzeit verfügbaren technischen Mittel ist das allerdings nicht überraschend. Es ist müssig zu behaupten, Tinguely und die andern Teilnehmenden der sagenhaften Präsentation «Le Mouvement» in der Galerie Denise René von 1955 seien die «echteren» Innovatoren gewesen. Denn damals war es bedeutend einfacher, das Publikum zu überraschen als heute, wo scheinbar alles möglich und alles schon dagewesen ist. Am meisten verblüfft hat uns Brigitte Zieglers «Shooting Wallpaper», eine biedermeierliche Tapeten-Projektion, die plötzlich lebendig wird. Mehr darüber und über alle andern Werke in einer ausführlichen Besprechung der Ausstellung und des Katalogs hier.
Katalog: Andres Pardey (Hrsg.). Métamatic Reloaded. (Beiträge von Michael Herer, Gianni Jetzer, Jitisdh Kallatr, Brian Kerstetter, Pamela M. Lee, Andres Pardey, Bénédicte Ramade, Julia Robinson, Andreas Schlaegel, Siebe Tettero, Ben Valentine, Roland Wetzel). Heidelberg 2013 (Kehrer Verlag), 240 Seiten, Deutsch-englische Ausgabe, CHF 42.00 im Museumsshop.
Illustration: Aleksandra Hirszfeld «Information Absorber» (Detail). © Aleksandra Hirszfeld, Foto Agata Kawecka

Katalog: Andres Pardey (Hrsg.). Métamatic Reloaded. (Beiträge von Michael Herer, Gianni Jetzer, Jitisdh Kallatr, Brian Kerstetter, Pamela M. Lee, Andres Pardey, Bénédicte Ramade, Julia Robinson, Andreas Schlaegel, Siebe Tettero, Ben Valentine, Roland Wetzel). Heidelberg 2013 (Kehrer Verlag), 240 Seiten, Deutsch-englische Ausgabe, CHF 42.00 im Museumsshop.
Illustration: Aleksandra Hirszfeld «Information Absorber» (Detail). © Aleksandra Hirszfeld, Foto Agata Kawecka
Maurizio Cattelan: Ein Wallach mit vier Stuten will bei Beyeler durch die Wand
10.06.13 18:23

In einem grosse Raum präsentiert die Fondation Beyeler in Riehen vom 8. Juni bis zum 6. Oktober 2013 Maurizio Cattelans Installation «Kaputt» – eine Neuinterpretation (oder Erweiterung) der im Jahr 2007 unter dem wenig aufschlussreichen Titel «Untitled» entstandenen Skulptur eines ausgestopften Pferdes, das buchstäblich die Wand hoch und durch sie hindurch geht. Diesmal sind es gleich fünf Braune, ein Wallach mit je zwei Stuten zu seiner Linken und Rechten, die ihre fatale Neugier befriedigen wollen. Der 1960 in Padua geborene Künstler, der teils in Mailand, teils in New York lebt, ist – wie in Basel seit der Ausstellung 1999 in der Kunsthalle allgemein bekannt ist – nicht nur ein Meister des bösartigen Humors, er pflegt auch sorgfältig seinen Ruf als notorischer Provokateur und Miesepeter, der die Öffentlichkeit meidet und Erklärungen zu seinen Werken verweigert. Das ist nun in Riehen nicht anders. Die Pferdegruppe wird als Solitär präsentiert, als ob es im grossen Raum keinen Platz für weitere Installationen gegeben hätte. Inhaltlich wenig konkret versuchte Beyeler-Direktor Sam Keller vor den Medien wortreich (und ausschliesslich in englischer Sprache – die ART steht vor der Tür!) zu erklären, weshalb Cattelan, der sein Werk 2011/2012 mit einer Retrospektive im New Yorker Guggenheim Museum abschloss und sich danach angeblich aufs Altenteil zurückgezogen hat, nun eine fünfjährige Idee neu zu beleben beliebte. Ist die Gruppe käuflich? Dient die Schau dem Handel? Unklar blieb vor allem, ob die Ausstellung, wie das Bild einer anderen Installation auf dem Plakat vermuten lässt, nicht auch andere Exponate hätte umfassen sollen. Auch der Kunstkritiker und Cattelan-Freund Francesco Bonami, der in einem als Saaltext publizierten Essay originelle Überlegungen zur Interpretation anbietet, mochte sich an der Präsentation nicht weiter über Details auslassen. Dank ihm wissen wir immerhin mehr über die Gründe, weshalb Cattelans Gäule durch die Wand gehen. «‹Was seht Ihr auf der anderen Seite der Wand?› ‹Nichts› oder vielleicht: ‹Nur einen Esel.›»
Zilvinas Kempinas: Licht, Luft und Videotape
04.06.13 13:34

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung folgt demnächst hier.
Max Ernst in der Fondation Beyeler
30.05.13 16:06

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung gibt es hier.
Louis Kahn im Vitra-Museum: Meister des Monumentalen
12.03.13 08:40


Mateo Kries, Jochen Eisenbrand, Stanislaus von Moos (Hrsg.): Louis Kahn – The Power of Architecture. Weil am Rhein 2012 (Vitra Design Museum),354 S. €79.90 (Deutsche und Englische Ausgabe).
Bilderchronik einer Avantgarde: Ad Petersen im Museum Tinguely
26.02.13 16:04

Annja Müller- Alsbach (Hrsg.): Ad Petersen. Les mille lieux de l’art. Luzern 2013 (Edizioni Periferia). 176 Seiten. CHF 38.00
Ferdinand Hodler bei Beyeler
24.01.13 16:27


Zur Ausstellung erschien ein opulent illustrierter Katalog. Jill Lloyd, Ulf Küster (Hrsg.): Ferdinand Holder. Riehen, New York, Ostfildern 2013 (Hatje Cantz Verlag) 220 Seiten; CHF 68.00.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalog steht hier.
Museum Tinguely: «Kuttlebutzer»-Fasnacht
23.01.13 19:27


Zur Ausstellung ist zum Preis von Fr. 7.65 eine Publikation in Form eines gefalteten Weltformat-Plakats erschienen, auf dessen Rückseite die ganze «Kuttlebutzer»-Geschichte von 1957 bis 1999 dargestellt ist. Zudem steht ein Inventar der Exponate zur Verfügung, das auch ihre Herkunft verzeichnet.
Illustration: Kuttlebutzer «Geisterzug» von 1965 ©Foto Rolf Jeck.
Tinguely@Tinguely: Ein schöner Moment
06.11.12 09:39

Andres Pardey (Hg.): Museum Tinguely Basel. Die Sammlung. Basel/Heidelberg 2012 (Museum Tinguely/Verlag Kehrer) 552 Seiten CHF 58.00 (Deutsche Ausgabe). Im Januar 2013 folgen eine englische und eine französische Ausgabe.
Pop-Art und Design: Ein spannender Dialog
14.10.12 13:57

Illustration: Studio 65, Leonardo, Sofa, 1969, Sammlung Vitra Design Museum © Studio 65, Foto: Andreas Sütterlin.
Edgar Degas als Wegbereiter der Moderne
14.10.12 12:06

Kritischer Blick auf Rousseau
08.07.12 10:26
Immanuel Kant brachte den Begriff 1784 auf den Punkt: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit». Wenn derzeit die Leistungen des Aufklärungs-Philosophen Jean-Jacques Rousseau zu seinem 300. Geburtstag in den höchsten Tönen gewürdigt werden, verschwimmt die präzise Definition des Königsberger Professors zu einem schöngeistigen Rauschen. Die Menschen sollten sich von der Vernunft leiten lassen, nicht von Religion und Aberglauben, hiess einer der Leitsätze, auf den sich die Aufklärer im Kreis der Enzyklopädisten um Denis Diderot verständigten. Das Individuum müsse sich der Fesseln der Tradition entledigen und sich von willkürlichen Machtansprüchen kirchlicher und weltlicher Obrigkeiten befreien. Im Gegensatz zu  Seinem Freund Diderot, der diese Grundsätze in aller Konsequenz verteidigte, zog es Jean-Jacques Rousseau vor, immer wieder Kompromisse zu machen. Er verkrachte sich mit seinen Freunden, die ihm seine Eskapaden immer wieder verziehen. Es gehört deshalb zu den Merkwürdigkeiten der Philosophie-Geschichte, dass nicht diejenigen, welche die Prinzipien der Aufklärung kompromisslos vertreten haben, für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit bewundert werden, sondern Rousseau, der aus Furcht vor dem Jüngsten Gericht viele seiner Überzeugungen preisgab. Seine geschmeidige Anpassung an das bourgeoise Mittelmass machte seinen Erfolg nachhaltig. Gemässigte Aufklärer wie Kant, Voltaire und Rousseau wollten Vernunft und Rationalität auf die Wissenschaften beschränken und das Volk nicht mit Religionskritik erschrecken, wie es die radikale Fraktion für notwendig hielt. Den Freundeskreis der radikalen Aufklärer um Denis Diderot, dem auch Jean-Jacques Rousseau eine Zeit lang angehörte, rettet ein ausgezeichnetes Buch des Kulturpublizisten Philipp Blom aus der Vergessenheit. Eine ausführliche Geschichte über das Buch gibt es hier.
Seinem Freund Diderot, der diese Grundsätze in aller Konsequenz verteidigte, zog es Jean-Jacques Rousseau vor, immer wieder Kompromisse zu machen. Er verkrachte sich mit seinen Freunden, die ihm seine Eskapaden immer wieder verziehen. Es gehört deshalb zu den Merkwürdigkeiten der Philosophie-Geschichte, dass nicht diejenigen, welche die Prinzipien der Aufklärung kompromisslos vertreten haben, für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit bewundert werden, sondern Rousseau, der aus Furcht vor dem Jüngsten Gericht viele seiner Überzeugungen preisgab. Seine geschmeidige Anpassung an das bourgeoise Mittelmass machte seinen Erfolg nachhaltig. Gemässigte Aufklärer wie Kant, Voltaire und Rousseau wollten Vernunft und Rationalität auf die Wissenschaften beschränken und das Volk nicht mit Religionskritik erschrecken, wie es die radikale Fraktion für notwendig hielt. Den Freundeskreis der radikalen Aufklärer um Denis Diderot, dem auch Jean-Jacques Rousseau eine Zeit lang angehörte, rettet ein ausgezeichnetes Buch des Kulturpublizisten Philipp Blom aus der Vergessenheit. Eine ausführliche Geschichte über das Buch gibt es hier.
Blom, Philipp: Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung. München 2010 (Hanser). 400 Seiten. € 24.90. Eine Taschenbuchausgabe erscheint 2013 bei dtv.
 S
SBlom, Philipp: Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung. München 2010 (Hanser). 400 Seiten. € 24.90. Eine Taschenbuchausgabe erscheint 2013 bei dtv.
Vladimir Tatlin im Museum Tinguely
05.06.12 13:26

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der Tatlins Leben und Werk im Licht der neusten Forschung darstellt.
Eine ausführliche Besprechung der fabelhaften Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Illustration: V. Tatlin vor dem Modell des Denkmals der III. Internationale 1920 (Ausschnitt) © 2012, A.G. Kaminskaya.
«Calder Gallery» bei Beyeler
25.05.12 12:27
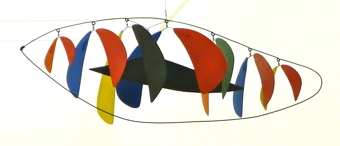
Gerrit Rietveld im Vitra-Museum
15.05.12 13:02

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Ida van Zijl: Gerrit Rietveld – Die Revolution des Raums.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Plädoyer für Jeff Koons
12.05.12 12:15

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des umfangreichen Katalogs gibt es hier.
Edward Kienholz und Nancy Reddin Kienholz: Zeichen der Zeit
06.03.12 14:54

Vera Isler zeigt Künstler-Porträts im Museum Tinguely
31.01.12 15:40

Zur Ausstellung, die 2011 auch im Museum der Moderne in Salzburg zu sehen war, erschien ein Katalog mit Texten von Jean-Christophe Ammann und Margit Zuckriegl. Vera Isler: Face to Face II. Weitra 2011 (Verlag Bibliothek der Provinz) 96 Seiten, CHF 22.00. Die polnischen Filmemacher Daria Kołacka und Piotr Dżumala porträtieren die Künstlerin in dem Film «Vera Isler – Einen Augenblitz, bitte». Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs steht hier.
Pierre Bonnard bei Beyeler
27.01.12 15:12
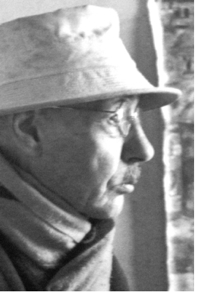
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Robert Breer – Pionier der bewegten Bilder
25.10.11 13:27
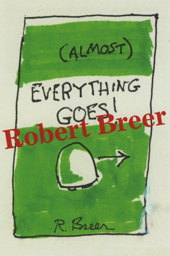
Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags
14.10.11 21:03

Surrealismus in Paris
29.09.11 16:45

Louise Bourgeois bei Beyeler
02.09.11 17:28

«Fetisch Auto» im Museum Tinguely
06.06.11 18:54

Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu lesen.
Brancusi und Serra bei Beyeler
21.05.11 15:00

Wicks «Bauchgefühl», dass Brancusi und Serra irgendwie seelenverwandt seien und zusammen gezeigt gehören, bleibt nach einem ersten Rundgang durch die sorgfältig arrangierte Ausstellung ein Bauchgefühl: Man wird den Eindruck nicht los, dass sich die Werke der beiden Koryphäen nicht allzu viel zu sagen haben. So sehr Serra schon als Kunststudent in Paris Brancusi bewunderte, in dessen rekonstruiertem Atelier er tagelang zeichnend hockte, so eigenständig hat er später sein skulpturales Werk entwickelt. Brancusis Einfluss auf alle, die nach ihm Kunstwerke in drei Dimensionen gestalteten, ist unbestritten.
Zur Ausstellung erschien ein Katalog, der alle versammelt, die sich über Serras und Brancusis Kunst kluge Gedanken machen.
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs ist hier zu lesen.
Stimme der Wölfin
30.03.11 16:17

Ein gutes Beispiel bietet Silvana Schmids Buch über die Tessiner Sängerin La Lupa. Dramaturgisch raffiniert entfaltet die erfahrene Journalistin und Autorin in acht Kapiteln das Leben der in Corbella im Onsernone-Tal aufgewachsenen Maryli Maura (Meri) Marconi. Kein Zweifel: Die Porträtierte trug durch ihre farbigen Erzählungen viel zu dem gelungenen, mit Fotos von Gitty Darugar illustrierten Werk bei.
Im Vorwort räumt Silvana Schmid ein, sie habe mit dem Ruf der La Lupa als herausragende Volksmusikerin zunächst wenig anfangen können – bis sie in Locarno einen ihrer Auftritte erlebte. Da war sie nicht nur von ihrer mitreissenden Stimme begeistert, sondern vor allem vom Raffinement des zweisprachig vorgetragenen Programms – und von der Ausstrahlung der authentischen Künstlerinnen-Persönlichkeit
Als sie der Tessinerin später auch in Zürich zufällig begegnete, reifte der Plan einer «Wegbeschreibung in Etappen»: Wie wurde La Lupa aus Corbella die bunte Wölfin der Zürcher Szene? Wie kam sie dazu, ihr Naturtalent zur Profession zu machen? Und wie schaffte sie es, dabei ihren ganz einzigartigen Stil zu entwickeln?
Es ist die grosse Stärke der Autorin, dass sie sich nicht damit begnügt, Antworten auf die selbst gestellten Fragen zu suchen. Vielmehr gelingt es ihr, das künstlerische Aufblühen der Tessinerin in die Zürcher Zeitläufte einzubetten: Der Globus-Krawall 1968, die Jugendbewegung der frühen achtziger Jahre haben La Lupas Leben ebenso geprägt, wie das vieler ihrer Altersgenossinnen und -genossen, besonders in den Kreisen der Künstler.
Dass Meri Marconi zur eigenständigen, selbstbewussten Künstlerin werden konnte, verdankte sie allerdings nicht dem Zeitgeist, sondern ihrer eigenen Hartnäckigkeit und dem innovativen Musiker-Milieu, in dem sie sich während vielen Jahren bewegte – bis ihr «System La Lupa» zur Reife kam: «Es ist massgeschneidert, wie die Kleider ihrer Nonna Miriam, massgeschneidert auf ihre Person und auf ihre Grenzgänge zwischen den Sprachen, den Kulturen, den Milieus und den musikalischen Genres, zwischen ihrer Spiritualität und ihrer Sinnesfreude», beschreibt Silvana Schmid die Basis einer unbeirrbaren künstlerischen Selbstsicherheit. Dazu gehört auch, dass sie die Zürcher Strassen täglich zur privaten Bühne macht, auf der sie in knallbunten, extravaganten Kleidern La Lupa zur Kultfigur stilisiert.
Nicht nur den Passanten, die ihr dabei begegnen – manche freudig überrascht über den Mut, manche leicht geniert ob der Exhibition – eröffnet Silvana Schmids Porträt überraschende Perspektiven, die vom Zürichsee bis ins Onsernone-Tal reichen.
Silvana Schmid: La Lupa. Die Stimme der Wölfin. Mit Fotografien von Gitty Darugar. Zürich 2011 (Limmat Verlag). 112 Seiten, 12 Fotografien. CHF 28.00; € 22.00
Arman – eine Werkschau im Museum Tinguely
15.02.11 15:10

Zur Ausstellung erschien ein sehr schön und sorgfältig gemachter Katalog.
Mehr über die Ausstellung den Katalog demnächst hier.
Illustration: Avant la chance, 1989 (Ausschnitt)
Giovanni Segantini in der Fondation Beyeler
16.01.11 17:16
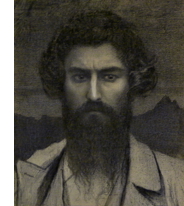
Under Destruction
17.10.10 18:27

Wien 1900 – ein Gesamtkunstwerk
24.09.10 21:10

Kunst in Fesseln
09.06.10 16:29
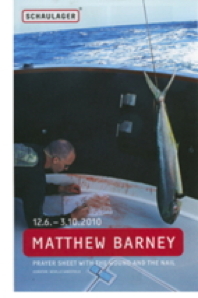
Roboterträume
08.06.10 15:42

Basquiat in der Fondation Beyeler
07.05.10 16:42

Die ausführliche Besprechung der Ausstellung und des Katalogs gibt es hier.
Der Erste Weltkrieg
05.05.10 14:27
Auf vier DVDs mit insgesamt über elfeinhalb Stunden Filmsequenzen entwickeln Heinz Bütler und Alexander Kluge mit Hilfe zahlreicher illustrer Expertinnen und Experten unter dem Titel «Der Erste Weltkrieg: Kunst und Krieg» ein umfassendes Panorama künstlerischer und politischer Weichenstellungen, die ein ganzes Jahrhundert zum Entgleisen brachten. Die Frucht der Zusammenarbeit zwischen NZZ Format und dctp.tv wird (für stolze 120 Franken) als «Sammlerobjekt» präsentiert und gleichzeitig als «Work in progress» relativiert. Für das Jubiläumsjahr 2014 steht eine ergänzte Fassung in Aussicht. Die von Heinz Bütler verantworteten beiden ersten DVDs befassen sich mit einzelnen Künstlern und ihren Kriegserfahrungen (DVD 1) sowie mit Dadaismus und Surrealismus (DVD 2). Alexander Kluge dokumentiert – mit einem bedeutend grösseren Stab von Mitarbeitenden und einem signifikant höheren intellektuellen und kreativen Aufwand – «Die Abwesenheit von Kriegskunst», zeigt «wie ein Jahrhundert entgleist» (DVD 3) und demonstriert die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit historischen Katastrophen (DVD 4) – denn «wer die Massaker nicht erinnert, pflegt sie.» Es liegt in der Natur der Materialsammlung, dass sich die Betrachtenden auf Längen und Unfertiges gefasst machen müssen. Das Begleitheft hilft, Schwerpunkte zu erkennen. Unsere kritische Besprechung steht hier.
Die Essenz der Dinge
23.03.10 11:26

VitraHaus in Weil am Rhein: Häuserstapel
13.02.10 10:24

Vom Kino zur Kinetik - die bewegte Kunst wird zur Kunstgewegung
09.02.10 19:39

Henri Rousseau in der Fondation Beyeler
07.02.10 13:08

Basler Fasnacht und Kunst
04.02.10 21:33
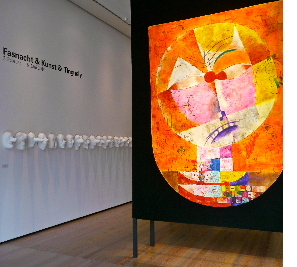
Jenny Holzer in der Fondation Beyeler
02.11.09 15:40

Rauschenberg bei Tinguely
22.10.09 09:26

Rauschenberg: «Trophy III (for Jean Tinguely)»
Eisen, Feuer und die Zeit
21.09.09 11:44

Kunst-Clan Giacometti
29.05.09 16:26

Rüstungen und Roben
12.05.09 09:00

Holbein bis Tillmans
01.04.09 13:52

Littmanns chinesischer Veloladen
10.02.09 19:57


Bilder © Jürg Bürgi (oben), Nils Fisch (unten).
Sammelsurium mit Seele
04.02.09 10:47

Bildwelten: Afrika, Ozeanien und die Moderne
23.01.09 19:16


Skulpturen indigener Künstler im Dialog mit Werken von Meistern der klassischen Moderne: Das ist die Grundidee der Ausstellung «Bildwelten – Afrika, Ozeanien und die Moderne» (25. Januar bis 24. Mai 2009) in der Fondation Beyeler in Riehen. Neu ist das Konzept zwar nicht, doch so konsequent und wagemutig wie Kurator Oliver Wick hat sich noch niemand an die Arbeit gemacht: In den Mittelpunkt des «visuellen Abenteuers» (Wick) stellte er in je sechs Räume Skulpturen-Gruppen aus Afrika und Ozeanien, insgesamt 197 Kunstwerke, und konfrontiert sie mit 44 Arbeiten, mehrheitlich Gemälden, der klassischen Moderne, 40 davon aus dem eigenen Sammlungsbestand. So eigenwillig wie die Ausstellung, so unkonventionell ist auch die Begleitpublikation: eine Pappschachtel. Sie enthält – zum Auseinanderfalten – 15 grossformatige Bildtafeln mit den Abbildungen der ausgestellten Werke und sachkundigen Erläuterungen, sowie eine 48 Seiten starke Broschüre, deren Haupttext anschaulich zeigt, wie verschieden Ethnologen und Kunsthistoriker mit den früher als «primitive Kunst» oder als «Art brut» etikettierten Werken umgehen. Mehr...
Jürg Hasslers Schach-Spiele
21.10.08 16:48

Schenkung Aeppli im Museum Tinguely
19.09.08 09:55
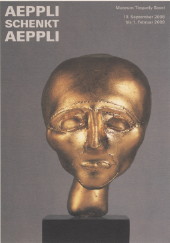
George Nelson – Architekt, Autor, Designer, Lehrer
15.09.08 16:39
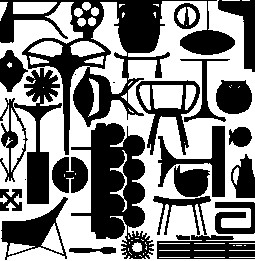
Fernand Léger: Brücke über den Ozean
30.05.08 10:12

Eine ausführliche Besprechung ist hier zu finden.
Im Massstab 1:1: Andrea Zittel und Monika Sosnowska im Schaulager
25.04.08 13:27

Was verbindet die beiden Frauen? Nichts. Was haben sie künstlerisch gemeinsam? Gar nichts. Weshalb ist ihr Schaffen nun gleichzeitig zu sehen? Weil Theodora Vischer «ein Gefühl hatte, ihre Werke zusammen ausstellen zu wollen», wie sie freimütig zugibt. «Im Nachhinein kann man es dann natürlich begründen.» Dabei ist dann in gescheitem Blabla die Rede davon, dass «beide auf ihre je eigene Umgebung reagieren». Pipifax! Wer tut das nicht in irgendeiner Form? Gäbe es echte Berührungspunkte, wäre es in der langen Vorbereitungszeit sicher zu einem irgendwie gearteten künstlerischen Dialog gekommen. Warum nicht einfach einräumen: Hier sind zwei grundverschiedene, eigenständige künstlerische Persönlichkeiten mit ihrem Werk zu entdecken, gleichzeitig und im gleichen Gebäude. Im Massstab 1:1, wie es der Titel der Ausstellung deklariert. Mehr...
Kunstmaschinen und Maschinenkunst
04.03.08 15:30

Hier steht die ausführliche Besprechung als PDF zur Verfügung.
Drei Perspektiven
03.02.08 17:06
Zugegeben: Eigentlich war nicht beabsichtigt, die Geschichte von Flucht und Vertreibung der europäischen Kultur- und Kunst-Prominenz aus dem Herrschaftsbereich der Nazis aus drei verschiedenen Perspektiven zu besprechen. Eigentlich wollte ich nur das Buch «Gehetzt» aus dem NZZ-Verlag vorstellen, das von Ruth Werfel konzipiert und, unterstützt von nicht weniger als 15 wohlmeinenden Sponsoren, herausgegeben wurde. Enttäuscht über das ärgerlich unbefriedigende Ergebnis dieses Vorhabens kam ich auf die Idee, zwei weitere Bücher einzubeziehen, die sich mit dem Exil befassen, und zu empfehlen, sich dem wichtigen und spannenden Stoff nicht nur mit Hilfe einer einzigen Publikation zu nähern. Denn wiewohl die Literatur zu dem Thema kaum zu überblicken ist, gibt es immer wieder Versuche, es neu zu behandeln: zum Beispiel in Ausstellungen, im Roman oder anhand von Selbstzeugnissen. Ruth Werfel nutzte für eine Ausstellung gesammelte Dokumente sowie Kontakte zu einschlägig engagierten Forschenden zur Herausgabe ihres Sammelbandes – dessen reisserischer Titel den Inhalt allerdings nur unvollkommen widerspiegelt. Da passt es gut, dass Michael Lentz mit seinem ebenso phantasievollen wie historisch genauen Roman hilft, ein beklemmendes Stück Vergangenheit im Kopfkino der Lesenden lebendig zu machen. Und schon 1998 zeigte Marcus G. Patka mit seiner nach wie vor gültigen Bilder-Biografie über Egon Erwin Kisch, wie gut es durch kluge Auswahl von Texten und Dokumenten gelingt, aus prominenten Namen Menschen aus Fleisch und Blut zu profilieren. Mehr in der Besprechung (als PDF).
Action Painting: Grosse Gesten des gelenkten Zufalls
25.01.08 15:04

Die Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen dauert vom 27. Januar bis zum 12. Mai 2008
Eine ausführliche Besprechung der Ausstellung gibt es hier.
Hannah Höch
19.01.08 13:37
Es ist heute selten, dass sich beim Betrachten einer Kunstausstellung Überraschendes entdecken lässt. Die Shows der grossen Namen sind – nicht zuletzt wegen der horrenden Versicherungsprämien – sorgfältig auf den allgemeinen Publikumsgeschmack konzipierte Wanderunternehmen, die hie und da mit lokalen Leihgaben ein wenig aufgemotzt werden. Aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel derzeit die Retrospektive für Hannah Höch im Museum Tinguely in Basel. Sie zeigt das Werk einer eigenständigen und eigenwilligen Persönlichkeit und straft alle Lügen, die in der Höch lediglich das Berliner Dada-Groupie zu kennen glaubten, dessen Ehrgeiz darin bestand, mit den Künstler-Kollegen zu wetteifern. Die überzeugende Korrektur der weit verbreiteten Vorurteile gelingt in erster Linie dank der Sorgfalt, mit der die «Berlinische Galerie», das Museum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur des Landes Berlin, den Nachlass der Künstlerin verwalten und erforschen. Das Museum Tinguely zeigt das Material der Berliner Kollegen, neu arrangiert und durch Leihgaben ergänzt, als spannende Entdeckungsreise durch das weithin unbekannte Universum der Hannah Höch. Mehr...


